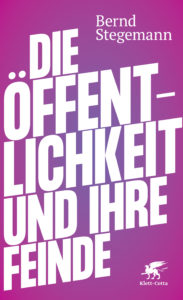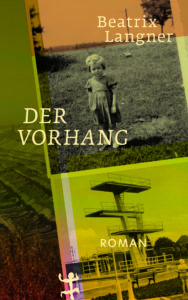
Eigentlich sind es vier Erzählungen, die die Literaturwissenschaftlerin Beatrix Langner in ihrem 190 Seiten-Roman »Der Vorhang« ineinander verwoben hat. Zum einen, jeweils in Kursivschrift, zu Beginn eines jeden der 27 Kapitel, ein wild-parodistischer Zeitenritt der ersten Menschin (wahlweise auch Behemots Tochter oder »ein Amphib«) durch die Erdgeschichte, über »känozoische Ufer« mit »jurassischem Sand« in »vortertiärem Untergrund«, einem »wie eine Glocke« schwingenden Erdmantel und dann feststellen, dass es am »diluvianischen Horizont« hell wird. Da jettet jemand 2496 Milliarden Jahre (unter Berücksichtigung einer von der Erzählerin eher langweilig empfundenen Episode von einer Milliarde Jahren) mit einem – wie sollte es anders sein – apokalyptischen Finale mit »rollenden Feuernestern«. Inspiriert werden diese Phantasmagorien durch die Riesenbagger, die seit Jahrzehnten in der Kölner Bucht die Landschaft umfräsen und von der Erzählerin in einer Mischung aus Abscheu und Faszination betrachtet werden. Dörfer werden umgesiedelt, Menschen ihrer Heimat beraubt (bisweilen sogar enteignet), nur (nur?) um Braunkohle zu fördern, die, wie sich jetzt einigermaßen überraschend herausstellt, für den drohenden Klimawandel nicht so günstig zu sein scheint.
Und dann gibt es noch die Ich-Erzählerin, die aus ihrer Kindheit erzählt, aus einer Stadt, die, warum auch immer, mit »E.« abgekürzt wird, obwohl man nach Sekunden erkennen kann, dass es wohl doch Erkelenz ist. Diese Kindheitserinnerungen wiederum werden ausgelöst durch die Betreuung, später Pflege der durch einen Schlaganfall und/oder Demenz gezeichneten Mutter, Jahrgang 1924, deren jahrelanger Verfall bis hin zu Windelhosen und Bettunterlagen in mitleidlosem Zorn erzählt wird. Da die Mutter auf die zahlreichen Fragen nicht mehr antworten kann (oder will), übernimmt die Tochter die Rekonstruktion ihres Lebens gleich selbst, lässt, wie es einmal heißt, die Zeit rückwärts laufen, füllt Leerstellen aus, imaginiert Ereignisse, die sie nicht erlebt hat, nicht erlebt haben kann und setzt dem (gewollten?) Vergessen das Fabulieren entgegen.