Ein Mensch sitzt in einem Raum, verdächtig eines nicht näher definierten Delikts. Eine Verhörsituation; ein Wärter, eine Kamerafrau. Ein Fetzen Papier als Indiz (für was?), ein Überbleibsel eines Autodafés? Die Uhr tickt zwar, aber im Leerlauf; die Zeit ist nicht ablesbar. Was ist geschehen?
Nicht einmal das Geschlecht des Ich-Erzählers ist klar. Als Beruf wird »Erfinder« angegeben, ein Erfinder von Fortsetzungsgeschichten, die in Frauenmagazinen erscheinen. Der Chefredakteur besteht nun auf ein Ende. Egal, welches. Die Frist läuft (im Gegensatz zur Uhr). Die Aufgabe stürzt die Erzählerin (ich nehme die weibliche Form) in eine existentielle Schaffenskrise. Dabei verselbständigen sich die Figuren und beginnen ein nahezu physisch empfundenes Eigenleben zu führen. Die eigene Existenz verschwimmt, die Gegenwart verschwindet in der Kindheit. Der Vater ein Tierpfleger (oder gar Zoobesitzer?), die Mutter streng und dominant; die Rollen sind klar verteilt. Ein verlorener, ums Leben gekommener Bruder? Gar ein Mord? Wer weiß. Es gibt Super-8-Filme von der Familie, tonlos, aber trotzdem im Nachhinein erschreckend. Ein Rückblende auf ein Weihnachten, ein Geschenk, der Wunsch, es möge kein Buch sein und es war doch eines und die Reaktion des »verschrobenen« Kindes. Dabei ist es ein Buch mit leeren Blättern, aber selbst hier bestimmt die Mutter, was von wem hineingeschrieben wird.
Den ganzen Beitrag »Erzählen ist ein gefährliches Spiel« hier bei Glanz und Elend weiterlesen.
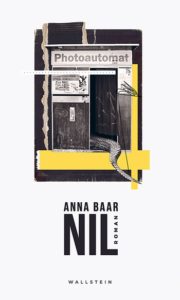
Hab’ da mal reingelesen, weil die Rezension neugierig macht.
Folgendes Zitat aus dem Anfangskapitel; es geht um den Besuch des Zoos, Arbeitsstelle des Vaters. Der Absatz beginnt mit einer imaginären Frage:
»Wovor fürchtest du dich? – Meine Beklemmung aber rührte nicht von der Furcht vor den armen Geschöpfen jenseits der riesigen Gitter, sondern von meinem Ekel vor seinem dummen Wahn, die Insassen zu beherrschen. Recht mäßig herrscht doch nur, wer das Wilde nicht einsperrt und schwächt, sondern in Freiheit bezähmt.«
Das ist ein welliges mundmalmiges Deutsch, nicht besonders eingängig. Inhaltlich streift die Autorin heftig die Leitplanke zum Absurden. Ich lese die Gegenüberstellung von zwei Gefühlen, welche das Erlebnissubjekt zugleich hat. Oder die Gefühle kommen hintereinander in der Erinnerung... Verbunden sind diese Komplexe mit der Zuschreibung von Kausalität, genauer einer richtigen und einer hypothetisch zweiten Kausalität. Dass eine Beklemmung von einer Furcht »kommt«, ist wenigstens unplausibel.
Der nachfolgende Satz ist beinahe gescheitert, oder aber ich habe die Inspiration einfach nicht verstanden. Hier wurde versucht, eine Dialektik auszuformulieren. Kommt mir vor wie Friedrich Schiller auf LSD. Es wird viel geherrscht, und frei gelassen, und dann doch schlussendlich gebändigt. Ein einziger Salat! Es geht noch so apodiktisch weiter nach diesem Zitat...
Verehrter Lothar Struck, waren Sie mal wieder zu nett?!
Ich weiß leider nicht, was »mundmalmig« bedeuten soll. Tatsächlich ist das Absurde, oder besser, das Surreale, ein Stilmittel des Romans. Dafür wäre es vielleicht nötig, ihn in Gänze zu lesen. »Friedrich Schiller auf LSD« klingt hingegen fürs Erste nicht schlecht. Ich weigere mich aber, Figuren einen Rausch zu attestieren, nur weil ich ihre Wahrnehmungen nicht nachvollziehen kann.