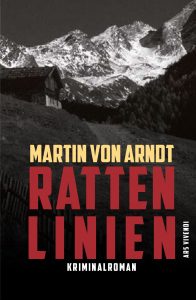
Dr. Andreas Eckart, Sohn italienisch-deutscher Eltern, Nervenarzt, Soldat für das Deutsche Kaiserreich und in den 1920er Jahren Kriminalkommissar in Berlin, sitzt im Herbst 1946 in einem Haus der Nähe von Washington und müht sich mit einer uralten Schreibmaschine in Übersetzungen von Büchern vom Deutschen ins Englische, die niemanden interessieren. Der Leser kennt Eckart aus Martin von Arndts Roman »Tage der Nemesis« als er 1921 in die Fallstricke türkisch-armenischer Geheimdienste und deutscher Außenpolitik geriet. Inzwischen sind 25 Jahre vergangen. Er lebt bei Liam, einem reichen und hemdsärmeligen ehemaligen amerikanischen Botschaftsangehörigen, der ihn in letzter Minute aus den Klauen der Gestapo in die Staaten schleusen konnte. Eckart, Moralist und Pazifist, wurde einst »Nazifresser« genannt, trat für die junge deutsche Demokratie ein, galt damit nach 1933 als politisch unzuverlässig und wurde schließlich entlassen. Die Hauptschuld hieran trägt sein ehemaliger Assistent Gerhard Wagner, der zum überzeugten Nazi und SS-Mann wird und sich an seinem ehemaligen Chef rächen will. Eckart wird zunächst drangsaliert, später gefoltert, soll Gesinnungsfreunde verraten, die inzwischen im Untergrund sind, so unter anderem auch seinen ehemaligen Assistenten Rosenberg. Gerade noch rechtzeitig gelingt die Flucht in die USA.
Mit sanftem Druck lässt sich Eckart im Herbst 1946 von seinen amerikanischen Freunden und Bekannten zur Teilnahme an der Operation »Rattenlinien« des US-Geheimdienstes CIC in Europa überreden. Hochrangige Nazis und SS-Offiziere versuchen über die Alpen bis nach Italien zu fliehen um von dort aus per Schiff nach Südamerika (Argentinien, Chile) zu kommen. Sie erhalten Hilfe von Sympathisanten aus Deutschland, Österreich (vor allem auch Südtirol), dem Roten Kreuz (welches mit verblüffender Naivität ausgestattet scheint) und dem Vatikan. Eckart und US-Special-Agent Dan Vanuzzi, Sohn italienischer Einwanderer, bilden zusammen mit zwei Helfern ein »Greifkommando« und sollen den SS-Obersturmbannführer Gerhard Wagner, der aktiv an Judenerschiessungen beteiligt war, aufspüren damit er vor Gericht gestellt werden kann. Dabei spricht die Physis gegen Eckart – er hat sich zwar von seiner Morphiumsucht befreit (er kehrte aus dem Ersten Weltkrieg als Kriegszitterer zurück), wurde jedoch zum Linkshänder (warum, erfährt man später), ist nicht besonders trainiert, hat Magenprobleme und ist 60 Jahre alt. Aber er kennt Wagner und dessen Mentalität, spricht italienisch und deutsch und der Appell, etwas Gutes zu tun, verfängt schließlich. Dabei gibt es zwei Probleme: Die Verwaltung in weiten Teilen Südtirols obliegt bei den Franzosen, so dass amerikanische Aktivitäten nicht gerne gesehen sind. Und wenn die Gesuchten erst einmal in Italien angekommen sind, endet der offizielle Einfluss der Amerikaner vollends, weil Italien ein souveränes Land ist.
