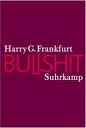Hier äusserte ich am Rande eine Kritik an dem (wie ich finde grässlichen) Anglizismus »Reading Room«, den die FAZ für ihren neu geschaffenes Bücherforum verwendet. Nun, es interessiert die FAZ natürlich nicht, wenn sich unsereiner von diesem Begriff geradezu angeekelt fühlt.

Nach Jonathan Littells »Die Wohlgesinnten« und Martins Walsers »Ein liebender Mann« wird nun Jutta Limbachs Buch »Hat Deutsch eine Zukunft« (mit der emphatisch überschriebenen Einführung »Mehr Deutsch wagen«) vorgestellt und die Thesen der Autorin diskutiert. Fast logisch, dass sich irgendwann die Frage stellt, warum man den englischen Ausdruck »Reading Room« verwendet und kein deutsches Wort finden wollte. Löblich, dass die FAZ dies nun seit dem 02. Mai mit Lesern diskutiert – mit dem merkwürdigen Untertitel in der Fragestellung: »Darf dieses Forum ‘Reading Room’ heissen?«
Merkwürdig deshalb, weil es kaum um ein »dürfen« geht – eher um ein »müssen«. Immerhin, es darf diskutiert werden. Wie schon vorher ist der Aufwand beträchtlich, die Software sehr gut. Die Beiträge werden moderiert – das ist bei der FAZ üblich. Bis zum 10. Mai will man Stimmen sammeln.
Weiterlesen ...