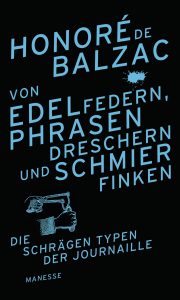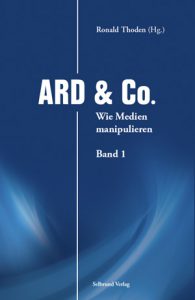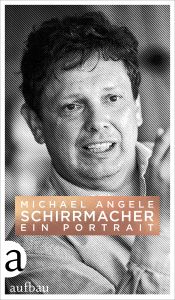
Schirrmacher – Ein Portrait
Zu Beginn seines als »Portrait« ausgewiesenen Buches berichtet Michael Angele, dass er nur zwei E‑Mails von Frank Schirrmacher erhalten hatte. Beide habe er gelöscht. Den Vorwurf der Nähe zu seinem portraitierten Subjekt kann man ihm also schwerlich machen. Im weiteren Verlauf des Buches wird diese Annahme bestätigt. Ich hingegen habe nur zwei Tweets von Schirrmacher erhalten. Einer als Reaktion auf diesen Text dessen Link ich ihm geschickt hatte. Er zeigt an, dass Thilo Sarrazin in seinem eurokritischen Buch zu einem großen Teil aus FAS und FAZ zitiert. Er fand das »sehr interessant« (mehr nicht). Von »Nähe« also auch bei mir keine Spur.
Es drohen zwei Szenarien mit einem Buch, dass sich »Schirrmacher« nennt: Zum einen könnte es eine Hagiographie werden. Oder jemand möchte Schirrmacher demontieren, dem arglosen Leser dunkle Seiten des Medienmenschen und Feuilletonisten enthüllen. Nach der Rezension in der SZ schien es sich um Letzteres zu handeln. Wobei Andrian Kreye wohl ein anderes Buch gelesen haben muss, denn um eine »Biografie« handelt es sich bei Angele nun wirklich nicht. Und ob Schirrmacher wirklich ein »brillanter Denker« war? Zweifel sind da erlaubt.
Aber was macht Angele? Er befragt Weggefährten, Kollegen, Mitleidende, Geschasste, Freunde, Kumpel. Am Ende, in einem sehr lesenswerten Epilog, auch noch Schirrmachers Mutter. Viele der Zeugen wollten anonym bleiben, was Angele akzeptiert aber nicht davon abhält, sie zu zitieren. Die Endnoten, die er setzt, geben das Datum des Gesprächs oder der Nachricht an, nicht deren Urheber. Angele lässt zuweilen auch divergierende Aussagen zu, was nur oberflächlich betrachtet beliebig genannt werden kann. Er weiss natürlich wie unzuverlässig Zeugen sind. Aber er zeigt damit, wie Schirrmacher längst in der Branche zum Mythos geworden ist. Da wird dann sogar der Vogelschiss »auf die Schulter des Herausgebers« bei einem Ausflug zum Niederwalddenkmal zum berichtens- und deutungswürdigen Detail.