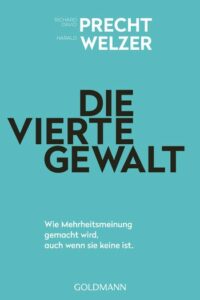
Die vierte Gewalt
Wenige Tage vor der offiziellen Veröffentlichung des Buches »Die vierte Gewalt« schlug den beiden Autoren für ihr Werk eine große Portion Häme und Unverständnis entgegen. Grund waren vor allem die für das Buchmarketing vorgenommenen (und von den Leitmedien bereitwillig geführten) Interviews, in dem beide (oder auch nur einer von beiden) vor allem ihre Position zum Russland-Ukraine-Krieg und den deutschen Waffenlieferungen noch einmal pointiert – und teilweise mit großer Arroganz – vorbrachten. Precht und Welzer sind gegen die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine (und zwar generell – nicht nur von Deutschland), weil sie eine Eskalation fürchten. Russland sei, so das Credo, Atommacht. Dass Atommächte in der Vergangenheit durchaus ihre Invasionen aufgrund zu hoher Gegenwehr abgebrochen haben, scheinen sie nicht zu wissen. Stattdessen schlagen sie Verhandlungen mit Putin vor, obwohl dessen Regime die Bedingungen hierfür mehrfach erklärt hat: Hierzu wäre die Kapitulation der Ukraine notwendig.
Mehrfach haben Precht wie auch Welzer (hier der Einfachheit halber mit der Sigle »WP« abgekürzt) in »Offenen Briefen« zur Einstellung der militärischen Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Dies und das aggressive Marketing führt zu fulminantem Widerspruch insbesondere in den sogenannten sozialen Medien (Twitter, Facebook). Dass die überwältigende Mehrzahl der Kritiker das Buch bis dahin nicht gelesen hatten (bzw. es nicht lesen konnten) spielt keine Rolle. Man schloss schlichtweg vom Inhalt der bisherigen Statements von WP auf das Buch.
Omnipräsente Darlings
Beide Autoren sind seit vielen Jahren publizistisch omnipräsent und man kann sie als Darlings des Medienbetriebs bezeichnen. Harald Welzer, Autor zahlreicher Bücher ist eine bekannte Figur der sich progressiv gebenden Degrowth-Bewegung und gerngesehener Gast in den Medien. Richard David Prechts Karriere verdankt sich vor allem dem öffentlich-rechtlichen System: es war die Literaturkritikerin Elke Heidenreich, die sein Buch »Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?« derart emphatisch lobte, dass es praktisch über Nacht zum Beststeller wurde. Zuschauer von populärwissenschaftlichen Sendungen konnten von da an dem sogenannten Philosophen Precht schwer entkommen; seine Bücher wurden stets in entsprechenden Sendungen »vorgestellt« (Euphemismus für beworben) und erreichten dementsprechend hohe Verkaufszahlen. Tatsächlich hat Precht keinen einzigen philosophischen Forschungsbeitrag publiziert und spielt in der akademischen Philosophie keine Rolle.
Nun haben also WP ein Buch geschrieben, in dem sie unter anderem beklagen, dass die so wichtig gewordenen Talkshowrunden im deutschen Fernsehen nicht paritätisch nach Umfrageergebnissen besetzt sind. Weil sie herausgefunden haben, dass im Frühjahr bis zu 46% der befragten deutschen Bevölkerung gegen Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gewesen sind, leiten die beiden daraus ab, dass Diskurse dieses (schwankende) Stimmungsbild jedes Mal abzubilden haben. Man sollte also keine Militärexperten, Geopolitikwissenschaftler oder Russlandforscher einladen, sondern, so wird suggeriert, vermehrt wissensferne Akteure, deren einzige Qualifikation darin besteht, eine bestimmte Meinungsquote zu erfüllen.
Interessant ist dabei, dass diese Diskussionsrunden von WP wie eine Art Ringkampf betrachtet werden, in dem es nur »pro« oder »contra« gibt. Zwar beklagen die beiden im Laufe des Buches exakt diese binäre Ausrichtung und setzen sich (etwas obskur formuliert) für »mehr als fünfzig Schattierungen von Grau« (wer kommt da nicht auf einen Buchtitel?) ein, die »nicht angemessen repräsentiert« seien – aber man selber betreibt das »Entweder-Oder«-Spiel sehr häufig.
