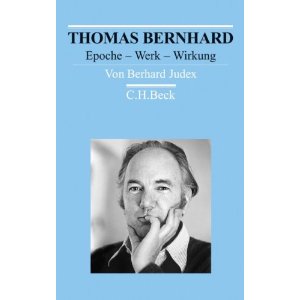
Bernhard Judex: Thomas Bernhard. Epoche – Werk – Wirkung
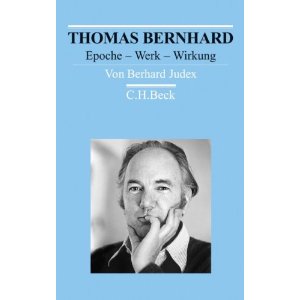
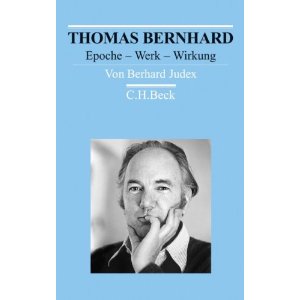
Wie führt man sich als neuer Feuilleton-Chef eigentlich in eine Redaktion ein? Welche Akzente setzt man? Was ist programmatisch zu erwarten? Schwierig. Richard Kämmerlings, von der F.A.Z. kommend seit 1. Oktober Chef des Feuilletons leitender Kulturredakteur bei der »Welt«, versucht es erst gar nicht mit Originalität. Er belebt eine Leiche, die man eigentlich vor einigen Jahre recht gerne zu Grabe getragen glaubte. Kämmerlings darf jetzt endlich darüber schreiben. Er will den »großen deutschen Roman«. Wobei dies nicht ganz stimmt. Damit jeder sofort weiß, wo die Vorbilder zu suchen sind, wird das Vermisste sofort anglifiziert: »Wo bleibt die Great German Novel?« Wow. Was für ein Mut!
Natürlich ist Jonathan Franzen das aktuelles Vorbild. Kämmerlings sucht nach einem Äquivalent, welches einem Amerikaner den Deutschen erklärt. Dabei geht er stillschweigend von zwei Prämissen aus: Zunächst glaubt er, Franzens Buch »erkläre« dem tumben Deutschen die amerikanische Seele. Und zum anderen glaubt er, Literatur als Referenz für eine Entität oder Nation heranziehen zu können.
Da ist es also wieder: Dieses Entsetzen der literarischen Welt, dass sich ihnen etwas anderes zeigt, als sie es in ihrer Villa Kunterbunt für möglich gehalten hätte. Der Schriftsteller Oskar Pastior war von 1961 bis 1968 Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate. Noch weiss niemand genau, was er dort getan hat. Es steht aber zu befürchten, dass diese sogenannte Aufarbeitung noch hunderten von Bäumen das Leben kosten wird. Keine Nuance wird nicht ausgebreitet werden. Schon jetzt bekunden alle ihre »Betroffenheit«. Wer das nicht bei Drei pflichtschuldigst abgeliefert hat, droht Amelie-Fried-mässig boykottiert zu werden (wobei das ja eher Ehre als Pein ist). Besonders »betroffen« ist natürlich Herta Nobelpreisträgerin Müller, die mit Pastior an ihrem Buch »Atemschaukel« bis zu dessen Tod gearbeitet hatte. Da war der Securitate-Dienst schon mehr als 40 Jahre vorbei.
Pastior war 1968 im Westen geblieben. Als reiche dies nicht. Als genüge dieses selbstgewählte Exil nicht als Beleg für die Verzweiflung. Als würde diese von Pastior vermutlich aus Scham verschwiegene Mitarbeit irgendetwas fundamental ändern.
Zugegeben, dieser Satz ist arg provokativ:
Der Literaturbetrieb hat das literarische Leben geradezu vernichtet.
Und Heinz Pleschinski relativiert ihn auch sofort wieder: Schuldige sind schwerlich zu benennen. Doch selbst der Literaturbetrieb ist nur ein winziges Segment im allgemeinen Trend zur Verflachung. Wer Buchinhalte referiert, erntet ein Gähnen – niemand will mehr ruhig zuhören – allein die Verkaufszahlen halten in Atem und fungieren als Qualitätssiegel. Der Kampf um den Absatz bestimmt alles. Lektoren und Verleger winken ab und das Vertriebspersonal senkt den Daumen, wenn ihnen ein sperriges Manuskript unter die Augen gerät.
So weit, so bekannt, möchte man meinen. Aber die weitere Lektüre des Artikels in der »Welt« (unter dem martialisch-trotzigen Titel »Wir müssen weiter ins Gefecht«) ist dennoch empfehlenswert und hebt sich von der allgemeinen Literaturkritik-Melancholie, welches im Moment die Feuilletons durchzieht (kein Wunder: die alten Männer treten ab und die Neuen sehen ihre Erbhöfe vor sich hin modernd), wohltuend ab.
Der Vorwurf des Plagiats ist der schlimmste, den man einem Schriftsteller machen kann. Daher sollte man mit solchen Beschuldigungen vorsichtig umgehen. Plagiatsgeschichten haben meist nicht nur Enthüllungscharakter. Die schlechten Enthüllungen denunzieren auch immer gleich mit. Es gibt zahlreiche Beispiele für Kampagnen, die gelegentlich durchaus die Intention hatten, Schriftsteller auch ökonomisch zu vernichten.
Die Definition von dem, was man »Plagiat« nennt, ist recht klar. Neben der rechtlichen Erklärung, gibt es auch eine ethische. Beide Interpretationen machen es so schwierig festzustellen, ob etwas Plagiat ist, ein Motiv verwandt wurde oder ob es eine Veränderung oder Weiterentwicklung eines Motives ist.
Deef Pirmasens hat in seinem Weblog »die gefühlskonserve« Helene Hegemanns Bestseller »Axolotl Roadkill« mit dem Buch »Strobo« des Bloggers »Airen« verglichen und verblüffende Parallelen festgestellt, die er ausführlich dokumentiert.
Verspätete Bemerkungen zu einer Pseudokritik über Stephan Thomes Buch »Grenzgang«
Stephan Thome hat einen Fehler gemacht. Er hatte sich in der Kulisse seines Heimatortes Biedenkopf für die Literaturbeilage der »Zeit« (Oktober 2009) fotografieren lassen (die Bilder sind nicht online). Eine Bildunterschrift lautet: »Stephan Thome lebt zwar gerade in Taiwan, geht hier aber im heimatlichen Biedenkopf für uns in die Hocke.« Jeder, der auch nur einen Funken Gefühl für Sprache hat, erkennt die verborgenen Invektiven. Zusammen mit der Rezension von Iris Radisch ergibt dies eine schwungvolle Denunziation des Romans »Grenzgang«.
Das Jahr 2009 erinnerte stark an 2006, als Katrin Passig in einem extrem schwachen Jahrgang reüssierte (was in einer beleidigten Attitüde umgehend dazu führte, dass man Novizen nicht mehr zuließ, sondern auf einer Publikation bestand). 2007 gab dann ein bisschen mehr her, aber im vergangenen Jahr rauschte das Niveau abermals nach unten (zumal man wirklich gute Beiträge auch noch aus Opportunitätsgründen verriss).
2009 ist nun mit fast neuer Jury abermals ein Tiefpunkt erreicht. Man fragt sich schon, wer eine Meike Feßmann als Jurorin auserkoren hat. Natürlich: Die Formalqualifikation stimmt und Frau Feßmann sagte ja auch wie eine brave Musterschülerin ihr angelerntes und angelesenes Wissen auf. Irgendwann teilte sie dann nur noch mit, ob ihr etwas gefallen habe oder nicht. Das füllt sie auch vollständig aus.
Der Germanist Alan Keele stellte neulich fest: Walter Kempowski hatte aus persönlichen Gründen in den Jahren 1947/48 Kontakt mit dem amerkanischen Geheimdienst CIC. (s. auch »Enthüllungsgeil«) Keele betonte, dass dies keine sensationelle Enthüllung sei, sondern nichts mehr als eine Fußnote, wenn auch eine interessante. Der F.A.Z.-Redakteur Edo Reents machte daraus eine Sensation mit dem effekthascherischen Titel »Walter Kempowski war doch ein Spion«.