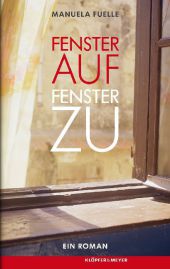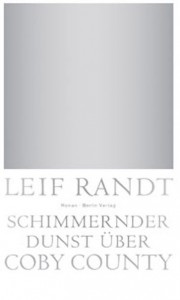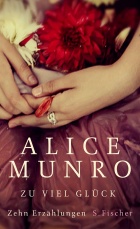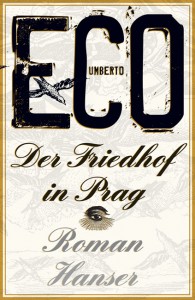
Rund 650.000 Exemplare sind von Umberto Ecos »Der Friedhof in Prag« seit Oktober 2010 in Italien verkauft worden. In Anbetracht dessen, welche Bücher in Deutschland Millionenauflagen erzielen, spricht das zunächst einmal deutlich für die Kulturnation Italien. In 40 Sprachen soll das Buch übersetzt werden. Mit der deutschen Ausgabe zieht der Hanser-Verlag alle Register seiner Marketing-Kunst. Es gibt für das Kritikervolk sogar ein »Einlesebuch« – unter anderem mit Personen- und Zeitregister zum Roman und einem Aufsatz über Verschwörungstheorien von Philipp Blom. Dieser schreibt, es sei letztlich gleichgültig, ob Verschwörungstheorien wahr seien oder nicht. Sie müssten nur »ausreichend viel Wahrheit beinhalten, um plausibel zu sein«, aber ihre »eigentliche Kraft« läge im »emotionalen Sog…im Versprechen von Sinn, von einem Ganzen, an das man glauben kann und dessen Teil man wird«. Das ist natürlich nicht falsch, erklärt aber nicht den Sog von Verschwörungstheorien, die, je nach Lage, komplizierte Vorgänge radikal vereinfachen oder auch einfache Ereignisse mit Komplexität aufladen.