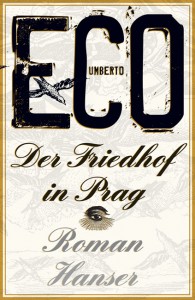
Rund 650.000 Exemplare sind von Umberto Ecos »Der Friedhof in Prag« seit Oktober 2010 in Italien verkauft worden. In Anbetracht dessen, welche Bücher in Deutschland Millionenauflagen erzielen, spricht das zunächst einmal deutlich für die Kulturnation Italien. In 40 Sprachen soll das Buch übersetzt werden. Mit der deutschen Ausgabe zieht der Hanser-Verlag alle Register seiner Marketing-Kunst. Es gibt für das Kritikervolk sogar ein »Einlesebuch« – unter anderem mit Personen- und Zeitregister zum Roman und einem Aufsatz über Verschwörungstheorien von Philipp Blom. Dieser schreibt, es sei letztlich gleichgültig, ob Verschwörungstheorien wahr seien oder nicht. Sie müssten nur »ausreichend viel Wahrheit beinhalten, um plausibel zu sein«, aber ihre »eigentliche Kraft« läge im »emotionalen Sog…im Versprechen von Sinn, von einem Ganzen, an das man glauben kann und dessen Teil man wird«. Das ist natürlich nicht falsch, erklärt aber nicht den Sog von Verschwörungstheorien, die, je nach Lage, komplizierte Vorgänge radikal vereinfachen oder auch einfache Ereignisse mit Komplexität aufladen.
Vielleicht wagt man sich lieber ohne vorgefertigte (und unzulängliche) Erklärungsversuche in den Eco’schen Fabulierkosmos, einer Zeitmaschine in das 19. Jahrhundert des politischen Italien und Frankreich. Der Held des Buches ist ein Hauptmann Simonini, 1830 geboren, der zum zu Beginn der Erzählung 1897 alleine in einer Wohnung in Paris lebt. Er beginnt mit 67 ein Tagebuch, um sich seines Lebens zu erinnern. Ein Ratschlag eines gewissen »Dr. Froïde«, den er in einem Art »Ärzte-Salon« (oder besser: Stammtisch) kennenlernt und den er gar nicht schätzt (früh erfährt man warum: weil es sich um einen Juden handelt).
In dieses Tagebuch macht in Simoninis Abwesenheit ein gewisser Abbé Dalla Piccola seine Notizen, der einige Darstellungen ergänzt und ihnen zum Teil widerspricht. Simonini ist verblüfft über diese Einträge und fragt sich, wie ein fremder Mensch in seine Wohnung eindringen und sich im Tagebuch äußern kann – ohne dass er jemandem begegnet. Schließlich entdeckt er einen unterirdischen Gang, der aus seiner Wohnung in eine andere, spärlich eingerichtete Wohnung führt. Beiden kommt schließlich auch in den Sinn, dass sie ein und dieselbe Person sein könnten und zweifeln ihre jeweils eigene Existenz an. Sind sie doch von einer schrecklichen Vergesslichkeit geplagt, die sie zuweilen in den Wahnsinn zu treiben scheint und nur im Erzählen langsam weicht. Zur besseren Übersicht sind Simoninis und Dalla Piccolas Eintragungen in anderen Schriften abgedruckt. Hinzu kommt noch ein Erzähler (durchgängig in Fettdruck), der die niedergeschriebenen Ereignisse, Anekdoten und Episoden zusammenfasst und die unterschiedlichen Versionen kommentiert und gewichtet.
Es ist wohl dem Spieltrieb Ecos geschuldet, dieses umstandsvolle Erzählen gewählt zu haben und dem Buch noch eine Portion »Identitätssuche« hinzuzufügen. Als sich Simonini irgendwann erinnert, dass es Jahrzehnte vorher den Abbé Dalla Piccola umgebracht hatte, bleibt nur noch die Version der vorübergehenden Persönlichkeitsspaltung übrig. Eine eher phantasielos-müde Erklärung, die sich schon auf Seite 34 ankündigte und in etwa so vorhersehbar war wie der Donner einem Blitz folgt. Viel Getöse um einen Kunstkniff, der für den Verlauf des Buches bedeutungslos ist.
Sei’s drum: Die Kinder- und Jugendzeit Simoninis wird mit Schwung erzählt. Er wächst beim Großvater auf, einem glühenden Antisemiten, der die politisch-revolutionären Umtriebe des Sohnes, also Simoninis Vater, argwöhnisch beäugt. Schnell dringt man die Verschwörungswelt des Großvaters ein, der immer und überall Freimaurer, Templer, Illuminaten, Jesuiten und natürlich vor allem Juden als die Übel dieser Welt ausmacht. Dieses Denken prägt für immer den Enkel. Und so versteht man die ziemlich schockierenden misanthropisch-rassistischen Äußerungen Simoninis am Anfang, der an niemandem nur ein gutes Haar lässt und »odi ergo sum« (»Ich hasse, also bin ich«) zum Lebensmotto erhebt, wobei ihm Ironie oder Sarkasmus fremd sind (was der Leser früh mitbekommt).
Simonini studiert Jura. Als der Großvater stirbt, offenbart ihm der Testamentsvollstrecker, dass dieser entgegen der landläufigen Meinung bankrott war. Gnädigerweise übernimmt der Notar den schlagartig mittellos gewordenen jungen Mann in seine Dienste. Früh wird deutlich, welcher Art von Notar hier am Werk ist: Ein Fälscher – sowohl in eigener Sache als auch im Auftrag anderer – der nicht einfach plump Vorhandenes verändert, sondern neue »Tatsachen« selbst kreiert. So besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass der Notar das Testament seines Großvaters gefälscht hatte – alleine: es fehlt der Beweis.
Simonini fügt sich ein, lernt schnell, findet Gefallen an diesem Tun, übertrifft den Meister und wird sogar Mitarbeiter des Geheimdienstes. Bereitwillig schlüpft er in diese und jene Rolle, scheut nicht, sich als Abbé oder Jesuit zu verkleiden, agiert als Agent provocateur, inszeniert schwarze Messen oder ist einfach nur militärischer Ratgeber und kommt mit dem Volkshelden Garibaldi in Kontakt. Als der (politische) Boden in Turin zu heiß wird, geht er nach Paris, arbeitet sich dort ebenfalls hoch und spinnt mit Wonne Intrigen. Seine Masche ist simpel, aber enorm wirkungsvoll: Liegt gegen eine Person oder Gruppe gegen die intrigiert werden soll nichts vor, wird etwas konstruiert. Schließlich kann das frei Erfundene gar nicht oder nur schwer widerlegt werden. Es muss nur einigermaßen plausibel sein und eine gewisse Erwartungshaltung bedienen. Dabei verwendet Simonini häufig fiktionale, längst vergessene oder indizierte Texte (die niemand mehr kennt, eben weil sie lange verboten sind), die so lange bearbeitet werden, bis sie in das Konzept der Denunziation oder Verschwörung passen. Einmal organisiert Simonini ein Komplott, nur damit es dann mit Aplomb aufgedeckt werden kann. »Die Geheimdienste aller Länder glauben nur das, was sie schon einmal irgendwo gehört haben und weisen jede wirklich unerhörte Nachricht als unglaubwürdig zurück«, so seine verblüffende Quintessenz, die mühelos in die medial-hysterischen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts übertragbar sein dürfte.
Die »Provisionen« werden immer üppiger, zumal er die Aufwendungen an Gehilfen immer halbiert und damit noch zusätzlich kassiert. Hass zahlte sich aus. Und wenn Leute drohen, die Verschwörungen mit Fakten aufzudecken, schreckt Simonini auch nicht vor eigenhändigen Morden zurück. Als er Paris weilt, verbringt er die gemeuchelten Leichen unterirdisch in den Kloakengängen. Glücklicherweise geschieht dies nicht sehr oft. Zwischendurch wähnt man sich in der Küche Thomas Lievens, denn wie Simmels Held wartet Simonini mit allerlei Rezepten auf, die jedoch eher an die rustikale Innereien-Küche des Günter Grass erinnert (also ähnlich fürchterlich sein dürfte wie die unterkellerten Leichen).
Wenn es auch mal gegen die Freimaurer oder Jesuiten geht – alles wird überlagert vom paranoiden Judenhass Simoninis. Schon früh schreibt er ein Pamphlet über die Versammlung der zwölf Stämme – symbolisiert durch zwölf Rabbiner – auf dem jüdischen Friedhof von Prag, in dem der Plan der Juden, die Weltmacht zu übernehmen, »dokumentiert« wird. Dabei bedient er sich diverser fiktionaler Quellen, von Alexandre Dumas über Eugène Sue und einem satirischen Text eines Maurice Joly. All dies wird von Eco ausführlich, nachvollziehbar und mit viel Liebe zum philologischen Detail ausgebreitet. Schließlich sucht Simonini – ein großer Deutschenhasser – dann sogar den deutschen Antisemiten Hermann Goedsche auf, der unter dem Pseudonym »Sir John Retcliffe« tatsächlich in seinem Roman »Biarritz« (von 1868) plagiatorisch Simoninis Texte verwendet. Man schätzt sich nicht, die Gesinnung verbindet aber mindestens für kurze Zeit.
Das Pamphlet der Versammlung der zwölf Rabbiner zu Prag wird die große Klammer in Ecos Buch und Simoninis »Lebenswerk«. Am Ende wird er gezwungen, das »Dokument« für die Russen zu perfektionieren und selbst Simonini fragt sich einmal, was denn die Juden noch alles verbrochen haben sollen. Der Rest der Geschichte, der im Nachwort nur ganz kurz angerissen wird, ist bekannt: Das Buch wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Russland »erstmalig« publiziert – unter dem Titel der »Protokolle der Weisen von Zion«. Der traurige Ruhm dieses Machwerkes ist bis heute zu beobachten, obwohl es bereits in den 1920er Jahren als plumpe Fälschung entlarvt und als eine Zusammenstellung diverser Schauergeschichten überführt wurde. All das hat nicht verhindert, dass die »Protokolle« von den Nazis als »wissenschaftlicher« Beleg für die »jüdische Weltverschwörung« dienten und damit die Vernichtung der europäischen Juden gerechtfertigt wurde.
Eco lässt (unglücklicherweise) viele bekannte (und auch weniger bekannte) Antisemiten des 19. Jahrhunderts auftreten, wie beispielsweise Henri-Roger Gougenot des Mousseaux, Alphone Toussenel, Edouard Drumont und Joseph-Antoine Boullan. Mehr als nur einmal fragt man sich, ob nicht weniger mehr gewesen wäre und wem dieses Namedropping dienen soll. Die Äußerungen der Protagonisten sollen, so im Nachwort, sämtlich verbürgt sein, wenn auch teilweise szenisch verfremdet. Einzig die Hauptfigur sei erfunden, wobei Eco nebulös die Option anbietet, Simonini sei »immer noch unter uns« und somit seinen fiktiven Helden – wenig überzeugend – als untoten Verschwörungs-Mephisto anbietet.
Ecos Vergnügen an der Dekonstruktion dieser eigentlich lächerlichen und plumpen Lüge, die sich in den »Protokollen« manifestiert, treibt zuweilen seltsame Blüten. Da schwadronieren Figuren von der »Endlösung« oder der Ausrottung; fast natürlich, dass auch irgendeiner von »Arbeit macht frei« spricht. Einige der zahlreichen Illustrationen des Buches sind schreckliche antisemitische Karikaturen. Hier spielt Eco mit einer Mischung aus Schonungslosigkeit und Entzücken mit den Entrüstungsaffekten seiner Leser. Problematisch ist dabei weniger die (zuweilen plumpe) Intertextualität, der exzessiv gefrönt wird, als die Vermischung zwischen Realität und Fiktion. Wie Jonathan Littells SS-Offizier Maximillian Aue ist Simonini häufig mitten in den Brennpunkten des weltgeschichtlichen Geschehens. So auch in der Dreyfus-Affäre, in der natürlich er die Bordereau schreibt und von Esterházy nur entsprechend instruiert wird. Eco treibt – und hierin liegt die Crux dieses Buches – die bestehenden Verschwörungstheorien mit neuen Verschwörungstheorien aus. Man fragt sich warum.
Zwar mag dies intellektuell reizvoll sein, aber der Leser des 21. Jahrhunderts weiß nun einmal mehr als die Figuren des 19. Jahrhunderts, so dass einem die Faszination ob dieser Machwerke ein bisschen wie klebriger Honig vorkommt, der vom Brötchen heruntertropft und die Finger benetzt. Der aufklärerische Impetus, den Eco sicherlich intendiert, greift nur bedingt: Zu lächerlich und fast tölpelhaft erscheinen die Protagonisten und zu weit entrückt (und dem deutschen Leser auch eher unvertraut) erscheint diese Zeit. Und zu krampfhaft diese Kreation einer unsympathischen Hauptfigur bis hin zur physischen Hässlichkeit und geistigen Schlichtheit.
Die Kalamitäten des Buches: Einerseits fordert »Der Friedhof in Prag« den wissenden, fortgeschrittenen Leser. Andererseits braucht man dieser Zielgruppe kaum Wesen und Unwesen von Verschwörungstheorien zu erklären. Einerseits könnte dies ein niveauvoller Unterhaltungsroman sein. Andererseits bietet sich das Thema der »Protokolle« nur begrenzt dafür an. Einerseits folgt man der ornamental-ausschmückenden Sprache des Autors zunächst ganz gerne. Andererseits wird es ziemlich früh ziemlich zäh. Was bleibt ist ein schaler Geschmack. Nur die größten Freunde Ecos werden ihre Freude haben. Die anderen sollten Besseres lesen.

Hört sich an, wie »Das Foucaultsche Pendel« in gewendeten Kleidern: http://bonaventura.musagetes.de/2008/umberto-eco-das-foucaultsche-pendel/
@Bonaventura
Den Eindruck zum Foucaultschen Pendel teile ich vollständig. Ich hatte damals durchgehalten – hauptsächlich wegen dieser kleinen, eingestreuten Geschichte mit dem trompetespielenden Kind. Aber das war letztlich zu wenig. »Der Friedhof in Prag« ist m. E. noch wirrer und aufgeblasener; ein Windbeutel – allerdings mit Skandalisierungspotential. Ich bin gespannt, ob dies in Deutschland eine Antisemitismus-Debatte lostreten wird. (Damit das klar ist: Natürlich ist Eco kein Antisemit.)
Komisch. »Der Name der Rose« empfand ich tatsächlich als ein schönes Buch. Aber das war in einer anderen Zeit. Ich lese es nicht noch einmal. Vielleicht, um mir den Eindruck von damals nicht zu zerstören.
Also abhaken und andere Bücher kaufen und lesen. Was ist aber mit der italienischen Kulturnation? Was hat zum Teufel 650000 Italiener dazu gebracht, dieses Buch zu lesen, wenn sie es denn überhaupt gelesen haben?
Im Namen der Rose war wirklich ein tolles Buch, während ich das Foucaultsche Pendel schon nach dem ersten Viertel weggelegt habe.
Was mich verwundert, Michael Krüger ist doch ein kluger und kompetenter Leser und Verleger; geht es nur um die hohe Auflage und damit um Geld?
Ich weiss nicht genau, aber ich glaube, Eco ist in Italien noch populärer als in Deutschland. Er steht ja politisch auch glaskar gegen Berlusconi, was bei einigen vielleicht schon als Wert an sich gilt. Und ich verstehe schon, dass Hanser »seinen Autor« Eco auch weiter verlegt.
Wiederum äußerst gelungene Rezension, Herr @Keuschnig! Sehr gut formuliert und plastisch die bei Eco immer kunstvoll verknoteten Verwicklungen für den interessierten Leser-in-spe aufgelöst. Mit dieser Rezension kann ich Einiges anfangen, ja als »Nachschlagewerk« wiederholt lesen.
Eco ist eine spezielle Blüte des spielerischen Umgangs mit Sprache, Linguistik und Medienphilosophie, die ich als Konzept seiner Kunst SEHR schätze, weil ich zum SPIEL neige, aber ich mag seine Ausführungen des Konzepts nicht bedingungslos. Ja, ich finde, schon in der »Rose« zeigen sich die Schwächen professoraler Gelehrsamkeit und intertextueller Klebearbeit mit Lupe und Skalpell (so arbeitet Professor Eco tatsächlich: unter einem Vergrößerungsglas werden sündhaft teure Primärquellen, die sich kein sterblicher Autor leisten kann, aber von Eco über seine Assistenten antiquarisch besorgt wurden, auf verwertbare Stellen abgesucht, die irgendwelche EFFEKTE durch Verdrehung und Verschleifung versprechen ... ich sah es erstaunt im Fernsehen. Eco besitzt eine Bibliothek, für die braucht er eine eigene Standortkartei. 30.000 Bände. So in dieser Größenordnung. Das »Haus« entsprechend. Arno Schmidt hat, um Platz zu sparen, da nur auf Papierstreifen in Mikroschrift schreiben können ... .). Was ich bei Eco vermisse: Poesie. Ist mir alles zu kurzatmig. Und sehr viel Slapstick und Comic – auch in der Figurenzeichnung. Das arbeiten Sie gut heraus, Keuschnig. Man hat den Eindruck, als könne Eco nichts ERNST nehmen, als könne er nur ironisch und intelligent SPIELEN, auch mit »heißen Eisen«, bei denen sich seine guten Absichten unfreiwillig ins Gegenteil verkehren können. Bei Eco löst sich alle Welt in ein amüsantes Zeichenspiel auf. Er übersieht vielleicht, daß diese Zeichenspiele als Realia des Lebens ganz konkrete Dinge manifestieren. Die Namensliste und Ahnenkartei der Gestapo oder des Einwohneramtes sind auch simple Zeichenspiele: sie steuern und verwalten Menschenleben.
@Michael Plattner
Das, was Sie schreiben, war mir entgangen und ich erinnerte mich daran wieder beim lesen. Was Sie über das Spielen schreiben, ist vermutlich sehr zutreffend. Im konkreten, aktuellen Fall frage ich mich: Wer liest das eigentlich – mit Gewinn?
Enzyklopädisten mit Herz für Pinzetten und Zettelkästen.
Entschuldigen Sie bitte die Unterstellung, aber...
Nach den ersten drei Sätzen wusste ich: dies wird ein Verriss.
Das »umstandsvolle Erzählen« wird bei deutschen und erfolglosen Buchvollschreibern an dieser Stelle meist liebevoll und positiv gesehen und auseinanderklabüsert, bei einem lebensbetonenden, verspielten, humorvollen, ja: riesigerfolgreichen Weltklasseschriftsteller aber nicht.
Ist der Erfolg und die Reklame des Verlages Schuld an Gregor Keuschings »schalem Geschmack« bei der Lektüre? Ich vermute: ja. Die ersten drei Sätze....
@Klaus
Sie irren. Die Werbung ist mir eigentlich egal. Bzw.: Es ist schade, dass ein solches Buch gleich überall und sofort prominent bespiegelt wird, während andere Bücher ein Mauerblümchendasein fristen oder gar abgelehnt werden. Die Werbung ist nur deshalb interessant, weil sie überhaupt nötig zu sein scheint. An dieser Vehemenz könnte man feststellen, dass die bloße Tatsache, dass es den neuen Eco gibt, nicht mehr ausreicht.
(Ist für Sie Erfolglosigkeit per se Ausweis eines ästhetischen Urteils?)
Der schale Geschmack entsteht bei mir vor allem aus dem m. E. misslungenen Konstrukt, wie Eco dieses Thema behandelt: Er will eine Verschwörungstheorie mit einer anderen Verschwörungstheorie austreiben. Das ist weder besonders originell, noch wird es der Angelegenheit gerecht. Gestern habe ich auf 3sat in der »Kulturzeit« einen Bericht über dieses Buch gesehen (er war sehr, sehr schlecht). Eco wird dort – natürlich – befragt (als würde dies eine kritische Lesung ersetzen). Interessanterweise beginnt er mit der Verknüpfung der Thematik mit dem Nationalsozialismus und zitiert Hitler. Hierfür muss er natürlich ganz bis ans Ende des Buches blättern; das Zitat steht im Nachwort, in kleineren Buchstaben. Tatsächlich endet der Roman um 1902/03 (die [fiktive] Hauptfigur wird wohl bei einem Sprengstoffanschlag getötet). Alles, was danach folgt – also die Instrumentalisierung der Protokolle insbesondere von den Nazis – ist nicht Gegenstand des Buches.
Sie haben sicher recht, Herr Keuschnig, dass man den »Friedhof von Prag« nicht lesen muss. Die Parallelen mit dem »Foucaultschen Pendel« scheinen erdrückend und die Zelebrierung des antisemitischen Sumpfs des späten 19. Jahrhunders selbst in demonstrativ-kritischer Distanzierung scheint Anlass eher für Malaise als für Lesefreude zu sein. Dennoch möchte ich auf Milde plädieren. Umberto Ecos Lebensproblem ist die Suche nach einer identitätsstiftenden Wahrheit hinter den Worten, den Sätzen, den Bildern unserer vorgestanzten Kulturwelt. Ecos Bücher enthalten immer einen Schrei nach Selbstvergewisserung, der ja immer auch ein Schrei nach dem Vater ist. Aber der Himmel über dem Pendel oder der Trompete, und selbst die Gräber Prags sind erschreckend leer – alles ist Artefact. Jeder Satz verweist nur auf den nächsten und wie gehetzt arbeitet Eco einmal mehr den Karteikasten ab um nicht dem leeren Abgrund in der Mitte der Zettel zu verfallen. Im »Foucaltschen Pendel« wurde diese »semiosi illimitata« noch als Problem thematisiert und mit gutwillig-robustem »common sense« beantwortet. Jetzt scheint der Meister (und Eco war ein echter Meister der Linguistik und der Semiotik) zufrieden zu sein, Fälschungen der Fälschungen anzufertigen. Die mechanische Bewegung ersetzt die Hoffnung. Vielleicht können wir diese Bewegung aber dennoch gerade noch als eine Hoffnung auf Hoffnung anerkennen.
@JHK
Ein wunderbarer Kommentar. Vielen Dank.
Sie bringen diese mir ans Herz gegangene Trompetengeschichte aus dem Foucaultschen Pendel mit Ecos »Schrei nach Selbstvergewisserung« in Verbindung. Ich bin fast bereit, Ihrem Plädoyer stattzugeben.
Ich habe das Foucaultsche Pendel mindestens sechs Mal gelesen und fand es immer wieder faszinierend. Ich habe die verrückte Konstruktion einer Weltverschwörungstheorie durch die drei Verlagsleute sehr genossen.
Meine Begeisterung für Eco ließ allerdings mit dem nächsten Buch nach: Die »Insel des vorigen Tages« erschloss sich letztlich nur noch Sprachwissenschaftlern und Kulturtheoretikern, die die barocke Poetik kennen. Die weiteren Bücher haben mir auch nicht mehr sonderlich gefallen und ernsthaft enttäuscht war ich von »Die geheimnisvolle Flamme der Königin Loana«. Das war nur noch eine Aneinanderreihung von Bildern und dem Vorgang, die auf dem Dachboden auszugraben. Schrecklich langweilig.
Ecos Konzept, Texte neu zu kontextuieren, ist nicht das Problem an sich. Es wird erst dann zum Problem, wenn er darüber vergisst, eine gute Geschichte zu erzählen. Die ersten beiden Romane erzählten eine solche. Danach wurde es schon schwieriger, versank dann und wann in Reflektionen, es passierte in den Büchern nicht viel. In diesem Moment wurden sie dann tatsächlich nur noch ein literarisches Abbild von Querverweisen und Theorien. Jedenfalls gebiert Ecos Methode allein noch keine Geschichte. Letztlich war das Mordmotiv im »Namen der Rose« allzu konstruiert, aber man konnte darüber hinweg sehen, weil Eco einen veritablen Krimi erzählte, versetzt mit viel Ironie sowie guter Kenntnis des Mittelalters. In der »Insel des vorigen Tages« verliert sich die Handlung irgendwann im Geäst der Theorien zur Poetik. Da fehlte dann einfach eine Idee vom Ende der Geschichte, die in diesem Buch zumindest noch ganz schwungvoll begonnen hatte.
Ich bin seither sehr skeptisch, was Eco angeht.
@Milo
Ich habe nach dem Foucaultschen Pendel keine Eco-Romane mehr gelesen. Einen Versuch hatte ich aufgegeben; ich weiß nicht mehr, welches Buch es war. Das Pendel-Buch hatte mich einfach abgeschreckt.
Sie haben recht, dass Ecos Bücher auf Plot und Tempo angewiesen sind. Der grund liegt wohl darin, dass er eigentlich kein Literat ist, sondern eher ein fabulierlustiger Philologe, der Verschwörungstheorien mag und sie auch selber konstruiert. Hier liegt aber das Problem: Immer wieder kehrt Eco seinen Wissensfundus heraus, den er wie in einem Bauchladen dem Leser anbietet. Ich will jetzt nicht behaupten, dass der Leser überfordert wird – das alleine wäre dann kein Argument gegen das jeweilige Buch. Der Leser befindet sich bei Eco aber in der irgendwann unbequemen Rolle des reinen Wissenskonsumenten, der zur fast zwanghaften Verknüpfung unwichtiger und/oder nebensächlicher Handlungsstränge, die monströs aufgeblasen werden, gezwungen ist.
Der »Name der Rose« bedient eigentlich eher eine ganze Tradition, Krimis zu schreiben.
Es gibt eine ganze Reihe von Spannungsromanen, in denen die Handlung nach einem vorab konstruierten theoretischen Muster konstruiert worden ist. Mancher hat seine Krimihandlung aus einem Schachproblem abgeleitet (Perez-Reverte, Stephen L. Carter), Eco hat seine Morde der Apokalypse des Johannes folgen lassen. Damit bleibt er eigentlich dem Genre treu. Die in dem Buch verpackten Bildungsgüter sind nützliche Mittel, um das Geheimnis der Morde zu begreifen. Natürlich hat Eco noch mehr im Sinn, aber das kann man als Leser getrost beiseite lassen bei diesem Buch.
Das »Foucaultsche Pendel« passt auch noch in die Erwartungshaltung des Krimilesers. Es ist zwar kein Krimi, aber die Bastelei an der Welt-Verschwörungstheorie bedient doch Lesegewohnheiten. Schließlich füllen die Kommissare ja auch scheinbar harmlose Dinge mit Bedeutung an, entdecken sie als Zeichen für geheime Mordpläne, entwerfen spekulative Theorien darüber, was sie besagen und wer wann was getan haben könnte. Genauso habe ich das in dem Buch von Eco in Erinnerung. Insofern funktioniert der Roman. Auch hier brauchte man noch kein Sonderwissen, um das Buch zu verstehen. Und das angeführte Wissen war halt das Material für die Theorie, für das Who-dun-it.
Aber schon in der »Insel des vorigen Tages« ist der Leser ohne Spezialwissen hilflos. Der Roman ist nur noch mit wissenschaftlicher Kenntnis zu begreifen und bleibt dem Leser ohne solche einfach nur verschlossen. Da habe ich mich doch schon geärgert. Das Problem war, dass eben die Geschichte damit auch verloren ging, obwohl das Buch als Roman über wissenschaftliche Entdeckungen im 18. Jahrhundert begann und eigentlich hätte recht spannend werden können. Aber irgendwie fehlte diesem Buch eine eigene durchkomponierte Geschichte, die auch ohne Bildungsgüter hätte funktionieren können. Und das ist dann das Problem. Trägt die Geschichte nicht, bleibt nur noch ein großer Haufen Wissensbruchstücke für den Leser übrig.
Irgendwie ist ihm die Lust am Geschichtenerfinden zu sehr abhanden gekommen.
@Milo: Das hängt wohl sehr davon ab, was man von einem Buch oder Roman erwartet. Der Plot oder eine Geschichte wären mir z.B. nicht so wichtig, eher eine Idee/Form/Prinzip, die das Ganze über die volle Distanz trägt. – JHK’s Bemerkung geht ja vielleicht in eine ähnliche Richtung, indem er die Idee eines Metavergnügens angibt: man erfreue sich an dem um sich selbst kreisenden, implodierenden Ideenkarussell (das schon seine eigene Konstruiertheit zur Schau stellt)...
Mal findet man dieses Vergnügen, mal nicht – aber man sollte schon Gründe dafür geben können (so wie Sie das tun), so sehr das manchmal auch nachträgliche Rationalisierungen sein mögen.