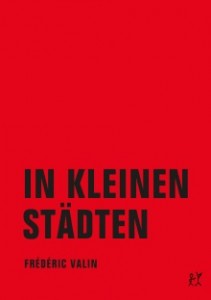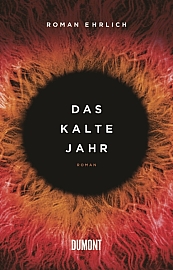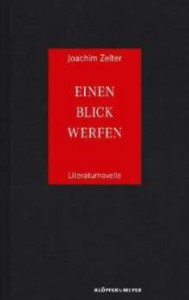Der bleiche König
Wo Johannes Jakobus Voskuil mit seiner Figur Maarten Koning in »Das Büro« den Büroangestellten der 1950er Jahre beschrieb(?), erzählte(?) oder einfach nur darstellte und vor allem bei den Kritikern auf Wohlgefallen oder sogar Begeisterung stieß für die ein Büro schon immer ein exterritorialer Un-Ort und Brutstätte der grauen Unterdurchschnittlichkeit gilt und die Kafka‑, Bartleby/Melville‑, Abschaffel/Genazino‑, Händler- oder Stromberg-Allegorien nur so aus den Zeilen purzeln, wo also das Vor-Urteil immer eine gute dreiviertel Länge Vorsprung vor der Erfahrung hat und niemals eingeholt werden kann, kommt natürlich auch ein Buch wie »Der bleiche König« von David Foster Wallace mit entsprechenden Vorschusslorbeeren in die Kaminzimmer des deutschen Literaturrichterwesens. Nichts lieber, als die eigenen Ressentiments wenn möglich wortgewaltig und mit der unvermeidlichen Portion Ironie bestätigt zu finden. Bei Wallace kommen noch zwei »Vorzüge« hinzu, die nahezu unschlagbar sind und immer Gewähr für Aufmerksamkeit gebieten: Er ist tot (weiterer Unter-Pluspunkt: Freitod) und er ist bzw. war Amerikaner. Aber dann bleibt der allzu große (Begeisterungs-)Sturm aus. Warum? Darauf wird noch einzugehen sein.
Zunächst: Wie weiland Andreas Maier, der zur Rezension von Günter Grass’ »Die Box« freimütig bekannte, vor diesem noch nie ein Buch von Grass gelesen zu haben, so gestehe ich dies in Bezug auf David Foster Wallace und dem »bleichen König«. Nun bin ich natürlich nicht Andreas Maier und möchte mich auch nicht mit ihm vergleichen, aber es kann schon manchmal ein Vorzug sein, einen Schriftsteller zum ersten Mal zu lesen. Die Fahnen zum »bleichen König« erreichten mich nur durch einen Zufall: ich wurde eingeladen, am »Social Reading« des Verlags teilzunehmen, was mir selbstverständlich unmöglich war, denn ich kann nicht in Gemeinschaft und/oder in vorgefassten Portionen lesen und trotzdem war der Verlag so freundlich mir ein Paket mit losen Blättern zu schicken (das Buch lässt immer noch auf sich warten; vermutlich spart man sich das bei zwielichtigen Onlineschreibern, was bedeutet, dass ich die Textstellen in den Fahnen, die mit schwarzen Quadraten statt Buchstaben versehen sind, nie werde nachlesen können). Die Entscheidung, nicht teilzunehmen, war richtig, denn die Teilnehmer, die schreibenden Leser der Seite waren/sind ausgesprochene Wallace-Experten und –Exegeten und sie lesen dann immer die ganzen anderen Bücher von Wallace sofort mit, entdecken Verknüpfungen und dies oft vor der Beschäftigung mit dem eigentlichen Gegenstand (vulgo: Roman), was kein Vorwurf ist sondern was ich selber kenne, wenn ich beispielsweise Bücher von Peter Handke, Josef Winkler, Rainer Rabowski oder Martin von Arndt lese.