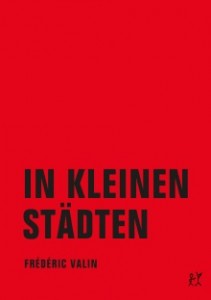
»Sylvia« ist leider nicht die stärkste Erzählung in Frédéric Valins Buch. Nicht, weil eine so ganz andere Welt als die des Zivildienstleistenden Kâzim aus Christoph Simons »Spaziergänger Zbinden« erscheint; eine Welt mit Trinkprotokollen, Tablettenmedikationen und befristeten Arbeitsverträgen. Valins Pfleger duzt Sylvia, seine Arbeitsauffassung ist unprätentiös, die Tonlage zuweilen pragmatisch-schnoddrig (etwa, wenn er darüber nachdenkt, wie körperlich gesund Demente doch sind, da sie eine umfassende und regelmässige ärztliche Versorgung erhalten) aber trotz allem niemals despektierlich oder gar zynisch. Die Erzählung fällt aus einem anderen Grund ein bisschen von den anderen ab: Die Klippen des Klischees, die sich beim Thema Alte und Pflege so bereitwillig auftun, vermag der Autor nicht ganz zu umkurven. Lieber hätte man gehabt, wenn der Pfleger über seinen Beruf im allgemeinen und über Sylvia im speziellen einfach erzählt hätte.
In der Geschichte mit dem verblüffenden Titel »Lea lacht« fährt ein Ich-Erzähler mit seiner Ex-Freundin Lea in den Urlaub an die portugiesische Algarveküste. Touristenhölle mit Rentnern und, vor allem, Engländern, diese »Hunnen der Gastronomie«. Schnell stellt sich die Langweile ein, die eine Erholung erzeugen soll in Wirklichkeit jedoch nur Ödnis schafft. Notdürftig wird der intellektuelle Appetit mit Besichtigungen lächerlicher Kirchen oder Kleinstädte gestillt. Insbesondere dem Mann überkommt eine in Ansätzen bemerkbare Meursault-hafte Gleichgültigkeit. Früh beginnen beide zu trinken. Am letzten Abend versucht er sich mit einer dänischen Abiturientin (»sie riecht nach Erdbeerkuchen« [wobei es eigentlich »duftet« heißen müsste]) und findet danach Lea mit dem russischen Barkeeper in ihrem Zimmer im Bett.
