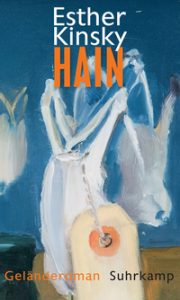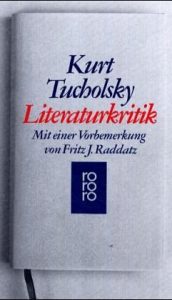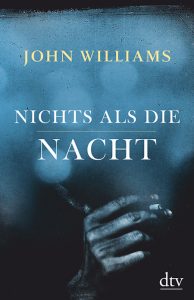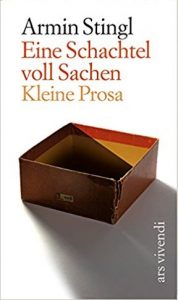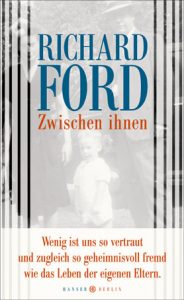Man glaubt es kaum, aber vor fast 40 Jahren betrat der Kärntner Schriftsteller Josef Winkler mit seinem wuchtig-expressiven »Menschenkind«-Roman erstmalig die literarische Bühne. In rascher Folge erschienen »Der Ackermann aus Kärnten« und »Muttersprache« – die »Ackermann«-Trilogie war geschaffen. Der »Ackermann« ist des Ich-Erzählers Vater, aber es war natürlich immer auch ein Synonym für eine bäuerliche Welt, katholisch geprägt, für eine gewisse Form von Rückständigkeit stehend. Der Erzähler in diesen Romanen schuf Satzmäander um Satzmäander, beherrschte die Kunst der Repetition, überließ (literarisch) rein gar nichts dem Zufall und verstand es den Leser gleichzeitig in Mitleid, Wut, Ekel und Faszination zu versetzen.
Selbst in gehöriger Entfernung von Kamering, jenem ominösen Kindheitsdorf, das mehr ist als nur ein Ort, sondern für eine Mentalität steht, fand der Ich-Erzähler nirgendwo Ruhe oder vielleicht sogar Weltvertrauen – weder in Italien (hier entstanden zwei Meisterwerke) oder Mexiko noch in Indien bei der fast mystisch-kontemplativen Beobachtung der Bestattungsriten. Überall wird er von seinem »Verfolgungswahn« eingeholt.
Bei allem Furor und der spürbaren existentiellen Notwendigkeit des Protagonisten, sich seinen Kindheitsdeformationen schreibend zu exorzieren kann ein genaues Studium vor allem der im Kärntner Milieu angesiedelten Bücher nicht verhehlen, dass hier bisweilen eine lustvolle Selbstviktimisierung inszeniert wird.