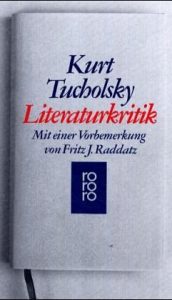Dominik Graf und Anatol Regnier untersuchen Motive und Befindlichkeiten von Schriftstellern, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland geblieben waren.
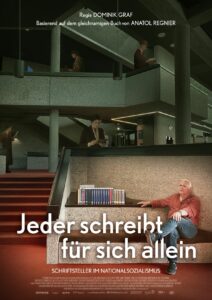
Jeder schreibt für sich allein
Seit fast 50 Jahren macht Dominik Graf Filme. Viele Fernsehspiele sind darunter, Krimis, Tatorte und Polizeirufe aber auch Dokumentar- und Literaturverfilmungen. Er ist einer der letzten Regisseure, die Fernsehproduktionen noch mit einem gewissen Anspruch ausstatten. Sein neuer Dokumentarfilm sprengt nicht nur hinsichtlich Thematik sondern vor allem wegen seiner Länge die »normalen«, scheinbar unhinterfragbaren Fundamente zeitgenössischen Fernsehschaffens. Einhundertsiebenundsechzig Minuten, also fast drei Stunden, dauert Jeder schreibt für sich allein und er zeigt Leben und Auskommen deutscher Schriftsteller, die während der NS-Zeit im Land verblieben waren.
Das Gerüst liefert das 2020 von Anatol Regnier publizierte Buch gleichen Titels. Regnier, 1945 geboren, ist der Sohn des Schauspielers Charles Regnier (bekannt aus zahlreichen Serien und Fernsehfilmen, aber auch als Komödiant) und Pamela Wedekind, der Tochter des Dramatikers Frank Wedekind und der Schauspielerin Tilly Newes. Anatol Regnier verfasste neben anderen Büchern 2008 eine vielbeachtete Biographie über Frank Wedekind.
In unterschiedlicher Intensität kreisen Buch und Film um das Verhalten von Gottfried Benn, Erich Kästner, Hans Fallada, Jochen Klepper, Hanns Johst, Ina Seidel und Will Vesper während der Zeit des Nationalsozialismus. Auf Börries von Münchhausen, Hans Grimm oder Agnes Miegel, auf die Regnier in seinem Buch näher eingeht, wird im Film verzichtet.
Im Film kommentieren die Eindrücke und Thesen unter anderem Florian Illies, Albert von Schirnding, Christoph Stölzl, Gabriele von Arnim, Julia Voss und Günter Rohrbach, der eine Sonderstellung einnimmt. Der inzwischen 94jährige Nestor des deutschen Qualitätsfernsehens erzählt im letzten Drittel in zwei Exkursen von seiner Kindheit und Jugend im saarländischen Neunkirchen. Ansonsten »moderiert« Anatol Regnier den Film als eine Art Erzähler; häufig im Gespräch mit Dominik Graf. Die ruhige, bisweilen anekdotische, aber niemals triviale Erzählweise des Buches wird behutsam auf den Film transferiert. Häufig wird ein Split-Screen eingesetzt, der das Gesagte mit Original-Bildern oder Filmsequenzen ergänzt und verdichtet. Ansonsten bleibt die Konzentration auf das Wort.

Der Anfang weicht vom Buch ab. 1945 versuchte der amerikanische Psychologe Douglas McGlashan Kelley mit Gesprächen und, das war neu, Rorschach-Tests den Seelenzustand der in Nürnberg angeklagten Nazi-Größen zu analysieren. Kelley suchte, wie es ein bisschen pathetisch heißt, »das Böse im Menschen«. In 22 cells in Nuremberg präsentierte er 1947 die Ergebnisse seiner Gespräche. Für die Analysen der Rorschach-Tests konsultierte er Fachleute und Experten. Aber deren Auswertungen wurden entgegen der Absichten nie veröffentlicht. Später hat es geheißen, man habe nicht das gefunden, was man erwartete. Diese Männer – gemeint sind die Kriegsverbrecher – wären keine »wahnsinnigen Kreaturen« gewesen; Neurotiker hätten sich darunter befunden aber auch einfach nur Opportunisten; eigentlich, und das ist das erschreckende, handelte es sich um »normale« Menschen.