Bemerkungen über einen Kritiker
Über Hans Falladas »Bauern, Bonzen und Bomben« schreibt der Rezensent 1931 unter anderem:»Die Technik ist simpel; es ist der brave, gute, alte Naturalismus, das Dichterische ist schwach, aber der Verfasser prätendiert auch gar nicht, ein großes Dichtwerk gegeben zu haben. […] Nein, ein großes Kunstwerk ist das nicht. Aber es ist echt…es ist so unheimlich echt, daß es einem graut.«
Und 1927 über Arnold Zweig und Lion Feuchtwanger:
»Wie groß der Kunstwille bei Autoren dieser Gattung ist, steht dahin – ihre handwerkliche Anständigkeit ist unbestreitbar.«
Man könnte auch noch Zitate zu Erich Maria Remarque und Ernst Toller bringen, die in die gleiche Kerbe schlagen: Literarisch – naja. Aber der Tenor – so gut, so treffend, so wichtig. 1928 versucht der Rezensent sich in eine (nicht ganz überzeugende) Verteidigung der (politisch gefärbten) »Gebrauchs-Lyrik« zu Gunsten der »Tendenzkunst«. Egon Erwin Kisch ist ihm in seinen Reportagen zu neutral; er vermisst etwas darin. Bei Grosz’ Bildern preist er, dass dieser nicht nur lache, sondern auch hasse.
Wer hat so geschrieben? Wer würde heute noch eine Literaturkritik schreiben, die derart Autor, Werk und Absicht trennt, dass der nationalistische Dichter Hans Grimm trotz seiner furchtbaren Bücher, die naturgemäß verrissen werden, als »anständiger Mann« bezeichnet wird? (Mit heute vergessenen Figuren wie Hermann Keyserling und Rudolf Herzog geht er ins süffisant-hart Gericht, aber es bleiben eher harmlose Schlechtschreiber. Aber instinktiv erkennt er in Arnolt Bronnen einen »von allen guten Geistern verlassenen Patriotenclown«.) Wer plädierte »die Dinge rein nach der Idee unter Ausschaltung ihrer menschlichen Träger zu beurteilen«?
Es ist eine zuweilen augenöffnende Lektüre, dieses kleine rororo-Bändchen mit dem Titel »Literaturkritik« mit von Fritz J. Raddatz ausgewählten Texten von Kurt Tucholsky. Der Band ist von 1985. Mein Exemplar gehört zur Ausgabe 32.–43. Tausend. Damals las man so etwas noch. Steffen Ille, dem Verleger meines Buches über Handkes Jugoslawien-Engagement, schickte mir im Sommer letzten Jahres dieses Bändchen. Er liest mit wie ich mich zuweilen an der aktuellen Literaturkritik reibe. Ich muss ihm danken, dass er mir dieses Buch geschickt hat.
Klar, Tucholsky war zunächst Literaturkritiker. Und dieser Band versammelt einige von seinen Kritiken (es sind 66 von insgesamt mehr als 500), die beweisen, wie scharfsinnig und vorausschauend seine literarischen Urteile waren. Benn und Brecht in einem Atemzug als die wichtigsten Lyriktalente zu erkennen – wer vermochte das damals schon. Ungewöhnlich für den zeitgenössischen Leser eine »richtige« Rezensionen zu Kafka (lobend) oder Joyce (eher zweifelnd). (Und dabei die Frage, wie wohl später die Rezensionen der heutigen Kritiker zu den dann zum Klassiker mutierten Schreibern rezipiert werden.) Und ja, manchmal ist er natürlich »Kind« seiner Zeit, etwa wenn er Irmgard Keun 1932 Talent attestiert (»aus dieser Frau kann einmal etwas werden«) nachdem er vorher »Gilgi, eine von uns« verrissen hatte.
In drei Abschnitte ist das Buch unterteilt, wobei die Titel mehr Fragen aufwerfen als Klarheiten vermitteln: »Jeder hat im Leben eine Melodie«, »S wie Sauersüss« und »Mancher lernt’s nie«. Innerhalb der jeweiligen Abschnitte gibt es keine chronologische Ordnung. Man meint man zu bemerken, wie ästhetische Urteile dem politischen Engagement immer mehr weichen. Aber auch hier lassen sich anhand der Jahreszahlen schwerlich Rückschlüsse ziehen. Natürlich wird es Ende der 20er/Anfang der 30er Jahre dringlicher, der Ton schärfer, die Kritiken auch zuweilen eine Spur ungerechter. Aber schon 1920 schreibt er über die Zeit knapp zehn Jahre zuvor seufzend: »Das war eine andre Zeit, und wir waren sehr glücklich. Kommt das je wieder?«
Tucholsky war – ähnlich wie ein Karl Kraus – zeit seines Lebens mit wirklich allem und allen unversöhnt, was mich dann doch zuweilen geärgert hat. Da ist seine Abrechnung mit der Sozialdemokratie (1926) und deren Funktionsträger in der Weimarer Republik. Musste man das derart vorbringen? Etwas mehr Nachsicht vielleicht wie er es etwa im Hinblick auf die KPD (die bessere Sozialdemokratie) und eben auch die Entwicklungen in Russland zeigt (die er nur sehr gemässigt kritisiert; er ist durchaus affiziert vom »neuen Rußland«)? Nicht, dass sich Tucholsky mit irgendwem oder irgendetwas gemein gemacht hätte, aber das junge Pflänzchen deutsche Demokratie war bedürftig nach Zuneigung und ihm vorzuwerfen, keine starken Äste hervorgebracht zu haben kommt einem heute etwas übereifrig vor. Sicher, für den Perfektionisten Tucholsky war »Realpolitiker« ein Schimpfwort; es mußte immer alles passen – und damit passte dann irgendwann nichts mehr. Und wie steht es mit seiner Art der »Kollektivschuldthese« der Deutschen (nebst den Österreichern) was den Ersten Weltkrieg angeht (der freilich damals nicht so genannt wurde). Auch hier ist er verbissen (nur an einer Stelle weitet er die »Schuld« aus) und die Eleganz mit der er beispielsweise das deutsche Militär und den Militarismus der Deutschen angreift, geht in diesem Rigorismus manchmal verloren.
Vor der eigenen Zunft macht sein Sarkasmus ebenfalls nicht Halt. In der Besprechung von Hugos Balls Buch über Hermann Hesse 1927 wird dieser kurzerhand zum »deutschen Menschen« erklärt und von nun an wird nichts mehr auf über den Literaten Hesse aber viel über den Deutschen und dessen Humorlosigkeit und über den »unendlichen Innenrummel« des Deutschen, der zum »Selbstzweck« wird, referiert. 1931 nimmt Tucholsky das noch einmal auf. In einer Besprechung über Uptons Sinclairs Essays beklagt er die Selbstreferentialität und Weltenferne der Literaten. Und das von einem, der Realpolitik furchtbar fand (siehe oben).
Auch mit dem Theater geht er 1932 hart ins Gericht. Stellenweise liest sich dies wie eine Kritik an das sogenannte Regietheater unserer Zeit. Die Regisseure »nehmen ein Stück nur im Hinblick auf diese Frage an: Was könnte man damit anfangen -? […] Sie drehen es. Sie wenden es. Sie dichten es um. Sie streichen und fügen hinzu.« Hierin sieht Tucholsky den Grund dafür, dass die zeitgenössische Dramatik stagniert. »Der Autor stört. Der Text ist Vorwand. Und dann beklagen sie sich, daß keine Dramatiker aufwachsen.« Und er empfiehlt erfrischend: »Dann schreibt euch eure Stücke allein.«
Hymniker ist Tucholsky allerdings auch. So lobt er überschwänglich die Schriften von Otto Flake und Emil Ludwig. Die Besprechungen von Essays oder Historienabhandlungen zeigen Tucholskys Kennerschaft. Und dann das Literarische: Wie er den »großen Epiker« B. Traven feiert. Oder den heute vergessenen Alexander Roda Roda. Von Haseks Schweijk-Bücher gar nicht erst zu reden (nur die Übersetzung kommt nicht gut weg). Ein satirischer Roman eines gewissen Linke Poot wird überschwänglich gelobt (wusste Tucholsky nicht, dass es sich um Alfred Döblin handelte?). Aber nie käme er in den Sinn hier »hohe Literatur« zu suchen oder die Bücher damit zu messen. Was für ihn zählt ist hier der Gehalt, die Pointe, die Botschaft.
Die Lektüre der einzelnen Texte verlangt und erzeugt Zeit. Über das Buch »Gesunde und kranke Nerven« des Psychoanalytikers Ludwig Paneth urteilt Tucholsky: »Es ist keine Bibel, sondern eine Fibel«. Desgleichen gilt für dieses Büchlein. Es ist eine Fibel für Kritiker, für Blogger, für Juryvorsitzende, für Schreiber und Leser. Es ist antiquarisch für kleines Geld zu beschaffen. Kauft, lest und lernt.
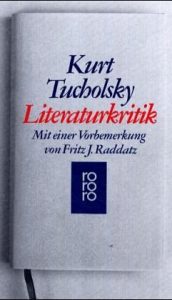
Vielen Dank für den Artikel und die Empfehlung. Ich glaube ein bisschen von dem, was Sie da beschreiben, nachvollziehen zu können. Das Deutsche Filmmuseum Frankfurt am Main brachte 1984 eine Textsammlung (herausgegeben von Fritz Güttinger) mit dem Titel “Kein Tag ohne Kino: Schriftsteller über den Stummfilm” heraus. Entdeckt habe ich sie vor weniger als 10 Jahren.
Es handelt sich dabei um Texte meist aus den 10er und 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Autoren sind Max Brod, Alfred Döblin, Georg Lukacs, Robert Musil, Bela Balazs und viele andere. Darunter auch Kurt Tucholsky.
Im Detail weiß ich nun nicht mehr die stärksten Texte, kann allgemein aber sagen, dass ich sie als Offenbarung empfand! Oder wie Sie schrieben, augenöffnend. Die Auseinandersetzung vieler Texte mit der Furcht, der Kientopp könne das Theater ablösen, wird mit so einer Leidenschaft geführt, einer Wortgewalt, die einfach in den Bann ziehen muss. Die Begeisterung und die Visionen, die aus vielen Texten sprechen, dazu der Versuch, die künstlerische und kulturelle Bedeutung darzustellen, in beide Richtungen, positiv wie negativ – all das hat mich doch nachhaltig beeindruckt.
Die besten Passagen sind zeitlos, so dass sie sich wunderbar auf Debatten unserer Tage übertragen lassen, wie z.B. das Ende des Kinos, das schon oft heraufbeschworen wurde, oder die Verschiebung von Kino zu digitalen Angeboten/Streaming. Im Kern auch der Umgang mit einem jungen Medium, die Verortung und Bedeutung für die Gesellschaft. (→ heute z.B. Internet).
Mich beschleicht das Gefühl, dass diese Debatten nicht mehr in dieser Art, vor allem auch sprachlich gesehen, ausgefochten werden. Womöglich gehen sie auch nur im großen Rauschen unter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Als sehr lohnenswert erachte ich die Lektüre allemal. Das 550 Seiten starke, gebundene Buch gibt es immer noch für schmale 12€ im Online-Shop des Filmmuseums Frankfurt zu beziehen. Ein weiteres gleicher Art für 10€.
Sehr schön und vielen Dank für diesen Hinweis.