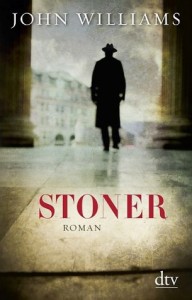
Wenn es ein Buch 2013 geschafft hat, die zuweilen konstatierte »Verkommenheit« des Literaturbetriebs (nicht nur Fritz J. Raddatz’ Urteil) für wenige, kostbare Augenblicke durch so etwas wie Empathie und Milde zu ersetzen, dann dürfte es John Williams’ »Stoner« gelungen sein. Kaum jemand konnte sich der Begeisterung entziehen, von Elke Heidenreich über Hubert Spiegel bis Ulrich Greiner, von »Bild«, über »FAZ« bis zum »Playboy« schienen alle versöhnt durch einen Roman der 1965 in den USA erschienen war und über Umwege erst seit einigen Jahren in den europäischen Sprachraum eindringt. Merkwürdig, dass dies in Deutschland so spät der Fall war – ein Land, indem ansonsten fast jedes Romandebut eines Schreibschul-Jüngelchens medial aufmotzt und auch schon einmal stante pede mit Tolstois »Krieg und Frieden« gleichgesetzt wird
Dabei ist »Stoner« ein vollkommen aus der Zeit gefallenes Buch. Es wird keine Zielgruppe bedient. Zeitgenössische »Problemstellungen« fehlen. Die Welt soll weder verbessert noch gerettet werden. Und alles spielt weit entfernt von unserer unmittelbaren Erfahrungswelt. Der Titelheld, William Stoner, ist 1891 geboren und stirbt 1965. Ein auktorialer Erzähler hält bis auf wenige Ausnahmen streng die Chronologie ein. Stoner ist der einzige Sohn eines Farmerehepaars, welches mit einfachsten Mitteln ihr Land bewirtschaftet. Die Eltern heißen Ma und Pa; die Arbeit dominiert das Leben. Der Sohn wird auf die Universität von Missouri nach Columbia geschickt. Er soll Agrarwissenschaften studieren und danach zurückkommen und die Farm übernehmen. 1910 betritt der junge Stoner die Universität. Bei dem Vetter seiner Mutter, der ebenfalls eine Farm besitzt, wohnt er auf Kost-und-Logis-Basis, die er fast mit Fronarbeit an Wochenenden und freien Tagen abzuarbeiten hat. Das naturwissenschaftliche Studium fällt ihm leicht. In einer Vorlesung über amerikanische Literatur begeistert ihn der Professor, Archer Sloane, mit einem Shakespeare-Sonnett. Praktisch sofort ändert er seine Pläne, schreibt sich in Literaturvorlesungen ein und gibt sein Agarstudium auf. Seinen Eltern sagt er dies erst, als er seinen Bachelor bekam. Später im Buch ist von einer »Epiphanie« Stoners die Rede, durch Worte etwas zu erkennen, was sich in Worte nicht fassen ließ; vielleicht wäre Initiation besser.
Die Universität als Zufluchtsort
Die andere entscheidende Szene, die sich immer wieder im Leben Stoners spiegeln wird, ist ein Abend beim Bier mit Dave Masters und Gordon Finch, zwei Kommilitonen, mit denen sich der schüchterne Stoner angefreundet hatte. Dave beginnt mit einer Suada über das wahre Wesen der Universität. Sie sei eine Klapse oder – wie nennt man das heute? – eine Art Seniorenheim, eine Zuflucht für die Gebrechlichen, die Alten, die Unzufriedenen oder die auf andere Weise Unzulänglichen. Gordon Finch, so Dave, sei der Unzulängliche, gerade mal klug genug um zu begreifen, wie es dir draußen in der Welt ergehen würde.Und William Stoner der Träumer, der Verrückte in einer noch verrückteren Welt, unser Don Quichotte des Mittleren Westens, der, wenn auch ohne Sancho, unter blauem Himmel herumtollt. Dave verschonte sich selber auch nicht. In einer Mischung aus Frechheit und Melancholie konstatierte er: Ich bin zu klug für diese Welt und kann den Mund nicht halten; gegen dieses Gebrechen ist kein Kraut gewachsen. Also muss ich dort eingesperrt werden, wo ich gefahrlos unverantwortlich sein, wo ich keinen Schaden anrichten kann.
So feuerzangenbowlesk diese Sprüche daherkommen – beim Lesen wird einem sofort klar, dass sie geradezu programmatisch für diesen Roman sind. Stoner wird die Universität Missouri in seinem ganzen Leben niemals mehr verlassen und der Don Quichotte des Mittleren Westens bleiben. Finch wird nach seiner Rückkehr vom freiwilligen Einsatz als Soldat im Ersten Weltkrieg sehr schnell seine Chance ergreifen, Karriere machen und am Ende Dekan sein. Die Freundschaft zwischen Stoner und Finch wird immer Bestand haben und auch die Intrigen, denen sich Stoner im Laufe seines Universitätslebens ausgesetzt sieht, werden von Finch zwischen den Möglichkeiten des informellen Verhaltenskanons und der Freundschaft der beiden immer ausbalanciert behandelt werden. Dave Masters aber, der genialisch-sehnsüchtige Zyniker, wird im Ersten Weltkrieg in Europa getötet werden. Immer, wenn in dem Buch jener Abend der Bewusstwerdung des universitären Parallellebens reflektiert werden wird, zeigt sich, wie dieser Dave Masters fehlt. Mit ihm wäre das Leben der beiden anders verlaufen.
Scheu und vorsichtig nähert sich Stoner dem Universitätsbetrieb, bekommt von Sloaner früh die Möglichkeit geboten, Kurse für Erstsemester zu geben. Schließlich spezialisiert er sich auf die (englische) Literatur der Renaissance. Sein Weg verläuft gradlinig, aber auch unspektakulär: 1914 Bachelor, 1918 Doktor. Bereits zu Beginn wird erzählt, dass Stoner zeit seines Lebens Assistenzprofessor bleiben wird; den Titel des ordentlichen Professors sollte er nie erhalten. Im weiteren Verlauf wird deutlich warum – immer kommt irgendeine universitäre Eigenheit – seien es Intrigen oder einfach nur Personalplanungen – dazwischen. Statt Karriere zu machen, geht es Stoner mehr um die Sache, um das Lehren und um die englische Literatur. Als er seinen Freund Finch mit seiner Ambition auf den Fachbereichsleiterposten in Verlegenheit bringen könnte, lehnt er (zur Erleichterung Finchs) schnell ab. Später wird er sich mit seinem designierten Chef Lomax anlegen, weil er Walker, einem von Lomax protegierten Studenten, durchfallen lassen will, weil er dessen Qualifikation als Lehrer in Zweifel zieht. Der Leser bekommt Einblick in das Universitätswesen, wobei es zwar um die Jahre zwischen 1910 bis 1956 in den USA geht, aber Parallelen zu tatsächlich immer noch existierenden Zuständen sicherlich nicht ganz abwegig sein dürften.
Es wäre ein Missverständnis, Stoner Opportunismus zu unterstellen. Das Gegenteil ist der Fall: Sein (Arbeits-)Ethos wird von der Liebe zur Literatur dominiert. Halbherzige Kompromissangebote lehnt er ab; lieber gibt er vollständig auf. Ein Kämpfer ist er nicht. So unterliegt Stoner in den entscheidenden Machtspielen in dem Apparat der von Dave so genannten »Unzulänglichen«. Die Konsequenzen erträgt er nach außen gleichmütig; die Parallelen zum Stoizismus des Farmbestellens seines Vaters (aber auch der Mutter) sind evident.
Ediths Launen
Den Gleichmut braucht William Stoner auch, wenn es um sein Privatleben geht. Er lernt 1918 die einige Jahre jüngere Edith Elaine Bostwik auf einer informellen Universitätsfeier kennen und verliebt sich sofort. Es gelingt ihm, die junge Frau kurz vor ihrer Rückkehr in ihr Elternhaus zu einer Art Gefühlsbeichte anzuregen. Sie ist Einzelkind, die Familie gut situiert; ihr Vater steht einer kleinen Bank vor. Stoner bekundet seine ernsten Absichten; die Eltern reagieren eher zurückhaltend. Edith stimmt schließlich zu: Steif und hochgewachsen stand sie vor ihm, das Gesicht blass – so heißt es unmittelbar nachdem beschlossen wurde, zu heiraten. Die junge, verwöhnte Edith ist lebensuntüchtig und auf eine geradezu anrührende Art unschuldig; die Flitterwochen sind keusch und die Erzählung hierüber ebenfalls. Kurz darauf entwickelt sie ein launenhaftes Wesen; vielleicht würde ihr heute eine bipolare Störung attestiert. Einige Jahre nach ihrer Hochzeit beschließt Edith plötzlich, dass sie ein Kind haben möchte. Für zwei Monate verändert sie sich nun: das einst schüchterne Mädchen wird wollüstig, was sich ebenso schnell legt wie es gekommen war.
Das Kind heißt Grace und im Laufe der Zeit hat man das Gefühl, es gebe einen Wettstreit der Eltern untereinander um das Kind. Mal kümmert sich Stoner um sie, macht nach dem Beruf noch den Haushalt, während Edith ermattet niederliegt. Dann wiederum zieht sie alle Aktivitäten an sich, schirmt Grace geradezu von ihrem Vater ab und verzieht sie. Das Verhältnis Stoners zu Edith nimmt nun dauerhaft Schaden, was er ihr jedoch nicht direkt zu verstehen gibt und sich nicht anmerken lässt.
Es gibt nun drei ständig miteinander verwobene Handlungsebenen im Roman: das Universitätsleben, die Ehe mit Edith und das Verhältnis zu Grace, welches je nach Situation von Edith bestimmt wird oder eben nicht. Selbst die Weltgeschichte (z. B. der aus der Ferne wahrgenommene Faschismus in Spanien und Deutschland) verändert kaum das Alltagsleben Stoners. Die Universität bleibt der perfekt abgeschottete Raum. Dies ändert sich nur zweimal: gleich zu Beginn mit Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg und dann 1942 mit Pearl Harbour. Diese Ereignisse spiegeln sich jedoch fast ausschließlich in Personalbelegungen des Unibetriebs – Studenten und Dozenten melden sich freiwillig zum Kriegseinsatz oder werden eingezogen.
Aber einmal, kurz nach seinem 40. Lebensjahr Stoners, geraten diese scheinbar fest zementierten Lebensstraßen für einige Monate durcheinander. Er lernt die 20 Jahre jüngere Studentin Katherine Driscoll kennen, die zunächst eine Auskunft über einen von ihr verfassten wissenschaftlichen Text wünscht. Stoner, der widerwillig zu lesen beginnt, entflammt sofort für die Arbeit – und gleichzeitig für die junge Frau. Hier entdeckt er endlich die Symbiose von Geist und Sinnlichkeit. Es ist zunächst vor allem der Intellekt der jungen Katherine, den er bei seiner Frau so schmerzlich entbehren muss. Stoner verliebt sich; es ist eine Liebe, die als Akt der Menschwerdung empfunden wird. Die beiden leben für kurze Zeit jede freie Minute in ihrer kleinen Wohnung, hausen wie zwei liebende Studenten. Er im zweiten Frühling; sie erfüllt von seinem großen Intellekt, von dem sie (fast als einzige) überzeugt ist. Edith bekommt Wind von der Affäre, duldet sie aber und Stoner ist überrascht, dass sich trotzdem das Verhältnis zu seiner Frau spürbar verbessert. Stoner widmet sich einerseits dieser auch sexuell anregenden und erfüllenden Affäre, andererseits dem Alltag in der Universität: Die Welt, in der sie lebten und die alles Gute in ihnen zum Vorschein brachte, war eine Welt des Dämmerlichts, so dass ihnen die äußere Welt, in der Menschen gingen und redeten, in der es Veränderung und stete Bewegung gab, nach einer Weile falsch und unnatürlich vorkam. Ihre Leben waren radikal in zwei Welten geteilt; und sie fanden es ganz natürlich, so geteilt zu leben.
Schließlich wird die Lage für den bigotten Universitätsbetrieb zu offensichtlich. Lomax, inzwischen Stoners Feind, droht mit Konsequenzen für Driscoll, die als Dozentin an der Universität arbeitet. Am Ende beugen sich beide; Stoner zieht die erbärmliche Sicherheit des Festangestellten vor und wagt nicht den Ausbruch mit Katherine. »Denn dann« erklärte es Stoner sich selbst, »würde all das keine Bedeutung haben – nichts von dem, was wir getan haben, was wir füreinander gewesen sind. Ich würde sicher nicht mehr unterrichten können, und du…du würdest zu einer anderen werden. Wir würden beide zu jemand anderem werden, zu jemand anderem als wir selbst. Wir würden zu – nichts.« Katherine verlässt die Universität und die Stadt. Beide verhalten sich streng vernünftig; aufsehenunerregend. Die Trennung der beiden, 14 Jahre vor William Stoners Tod, ist paradoxerweise eine der schönsten Stellen im Buch. Sie werden sich nie mehr wiedersehen, wie der Leser erfährt.
Zutiefst existentialistisch
Hier und an der Erzählung des Todes von Stoner auf den letzten Seiten zeigt sich, dass es sich bei Williams’ Roman um ein zutiefst existentialistisches Buch handelt. Und dies bis in den sprechenden Namen der Protagonisten. So ist Stoner Sisyphos, derjenige, der den Stein bewegt. Ein Mann, der sich in vorauseilendem Schicksals-Gehorsam einfügt und der sein Leben der Literatur und dem Lehrbetrieb untergeordnet hat. Dabei ist auch Stoner ein glücklicher Mensch – nicht trotz, sondern wegen seiner empfundenen Berufung. Passend dazu gibt auch keinen metaphysischen Trost; das Wort »Gott« fällt immer nur als Ausruf.
Wie Sloane altert er nach der aufgegebenen Liebe sichtbar. Ohne die existentialistische Sichtweise des Buches wäre es merkwürdig, ja fast widersprüchlich, dass der Erzähler zu erzählen weiss: Die Jahre, die unmittelbar auf das Ende des Zweiten Weltkriegs folgten, waren seine besten Jahre an der Universität und in mancher Hinsicht die glücklichsten Jahre seines Lebens. Also nicht die wenigen Monate der erfüllten Liebe mit Katherine, sondern die Jahre, als er nur selten von seiner Hingabe an die Arbeit abgelenkt wurde. Als er irgendwann Katherines Buch in Händen hielt (mit der Widmung für »W. S.«) heißt es zwar ganz kurz: Da brach sich das so lang aufgestaute Verlustgefühl Bahn, überflutete ihn, und er ließ sich mitreißen, verlor alle Beherrschung. Aber sofort danach lächelte er liebevoll wie über eine Erinnerung, und ihm kam der Gedanke, dass er auf die sechzig zuging, weshalb er eigentlich über solche Leidenschaften erhaben sein sollte, über eine solche Liebe. Nur einen kleinen Rest-Zweifel lässt er zu.
Die Anteilnahme, die selbst hartgesottene Leser diesem Buch, dieser Figur gegenüber zeigen, resultiert daraus, dass die Identifikation mit diesem Stoner so leicht gelingt. Wir sind alle ein bisschen (bzw., seien wir ehrlich, sehr viel) Stoner. Gleichzeitig suchen wir etwas jenseits materialistischer, ideologischer oder metaphysischer Tröstungen, was uns mit unserer Existenz versöhnt. Und dabei sind wir gerührt, wie sich Stoner mit seinen letzten Bewegungen auf dem Sterbebett an sein ihm fremd gewordenes, einziges Buch klammert (ein Projekt für ein zweites Buch hatte er aufgegeben) – als sei dies Sinn und Vermächtnis seines Lebens.
Die fulminante Sterbeszene entschädigt für einige Längen wie die Schilderung der Affäre um Lomax’ Protegé Charles Walker (»Walker«, der bestimmt ist, zu gehen – trotz mangelndem Talent; wieder so ein sprechender Name, wie auch »Driscoll«) oder die ausgiebigen Detailschilderungen der Edith-Gezeiten. Der Initiation für die Literatur durch Sloane fehlt ein wenig die Überzeugungskraft. Aber vielleicht musste das alles so geschrieben werden, weil erst dadurch die Durchschnittlichkeit von Leben und Werk William Stoners, also von uns allen, manifest wird. »Stoner« überzeugt nicht unbedingt als sprachliches Kunstwerk, sondern packt, ja reißt den Leser emotional mit. Das ist per se noch keine literarische Qualität. Aber Stoners gelebter Existentialismus, der die Bleiweste des Trübsinns abgestreift hat wie ein zu enges Kleidungsstück, vereint für einen Augenblick (fast) alle Leser in einer besonderen Form von Andacht. Das Buch erzeugt diese Expressivität unter jeglicher Vermeidung kitschiger Elemente oder süsslich-klebriger Sentimentalität. Und das ist eine große Leistung.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
