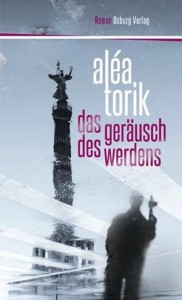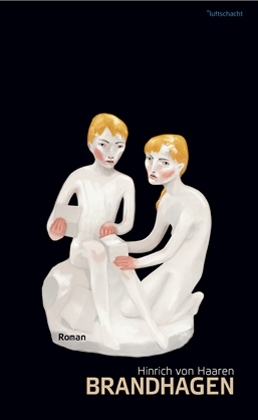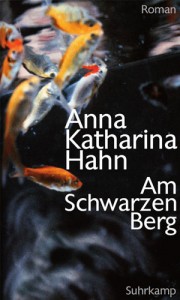Der Beitrag »Bücherliebhaber gegen ‘Hasen-Pups’ der »Berliner Zeitung« ist inzwischen mehrfach auf Facebook verlinkt und kommentiert worden. Berichtet wird von einem sogenannten »Top-Rezensenten« von Amazon, der inzwischen aufgrund von Cyber-Mobbing ausgestiegen sei. Er habe Drohbriefe erhalten und sei beschimpft worden. Der Leser wird mit der Suche nach den Gründen für diese Kampagnen alleine gelassen. Wen hatte Thorsten Wiedau denn derart angegriffen?
Auch die eingangs erwähnten Zahlen stimmen nachdenklich. In zehn Jahren will er 10.000 Bücher gelesen haben und hat 3.468 »Rezensionen« geschrieben (also fast täglich eine). Und dies, wie so oft betont wird, als »Hobbykritiker« mit teilweise 80 Stunden-Woche Arbeitszeit in seinem Beruf. Um eine Seite zu lesen brauche er, so der Bericht, 45 Sekunden. Für eine »Rezension« verwendet er 30 Minuten. Richtige Beschäftigung mit Literatur klingt anders.
Die 45 Sekunden lassen ahnen, wie dort jemand liest – der Autor Rudolf Novotny hat die Angaben des ehemaligen »Top-Rezensenten« vermutlich nicht überprüft: Bei einer 80 Std-Woche und einem Mittel von 6 Stunden Schlaf pro Nacht kommt man auf 46 Stunden Freizeit pro Woche (ohne beispielsweise Körperpflege und normale soziale Kontakte). 46 Stunden sind 165.600 Sekunden. Berücksichtigt man jetzt nicht weiter das Schreiben der sogenannten Rezension, so kann der Mann in einer Woche bei 45 Sekunden pro Seite 3.680 Seiten lesen. Er will 1.000 Bücher pro Jahr gelesen haben. Das wären 19 Bücher pro Woche. Demzufolge läge die durchschnittliche Seitenzahl pro gelesenem Buch bei 193 Seiten.