Allerlei Geheimnisvolles
Zunächst erinnert die von der alten Lehrerin erzählte Gründungslegende der Ortschaft ein bisschen an das berühmte Macondo. Es wird allerlei magisch-skurriles erzählt; der Tischler – der Außenseiter in der Dorfgemeinschaft (warum eigentlich? nur weil er schielte und/oder sein Haus etwas außerhalb stand?) – schnitzte sich seinen Sohn und plötzlich waren es Zwillinge. Andere Gerüchte spekulieren um eine gewisse Promiskuität der Frau. Die Söhne bekommen den gleichen Namen – nehmen aber dann doch überraschend vollkommen andere Entwicklungen. Einer bricht in die Stadt auf (welche auch immer gemeint sei), erscheint nur noch sporadisch im Dorf und wirkt wie eine Mischung aus Mafiosi und Hexenmeister.
Das Aufbruch-Motiv in Verbindung mit Abwesenheit ist sehr präsent in diesem Roman. Personen verschwinden scheinbar grundlos und ohne Andeutung. Da ist Valentin, der urplötzlich seine Freunde Ioan und Emil verließ. Die Abwesenheit der schönen Krisztina, Emils Tochter, bleibt ungeklärt; dieses Motiv könnte einem David-Lynch-Film entstammen. Die geheimnisvolle Lydija verlässt den Schuhmacher und Bürgermeister Ioan – und das kurz nach Geburt von Nicolae, ihrem gemeinsamen Sohn. Erst Jahrzehnte später taucht sie wieder auf – just in dem Moment da der inzwischen erwachsene Sohn wegläuft, sie anrempelt und ihr aufhilft und dabei nicht weiß, dass diese Frau seine Mutter ist. Das ist der schönste Moment ihres Lebens – aber leider wird einem die Schönheit des Augenblicks verdorben, weil Lydija kurz vorher, beim Anrempeln, ihrem Sohn ein Flugticket in die Jackentasche gesteckt hatte – so als hätte sie im voraus von ihrer Begegnung gewusst. Da wird die Mystik zum Stimmungstöter.
Ein Ankerpunkt im Roman ist die Ehe zwischen der karrieretüchtigen Zahnärztin Liv und dem zum Hausmann degradierten bzw. sich einfügenden Valentin. Dabei begann alles so einfühlsam und unbedarft. Valentin stieg in Berlin aus dem Zug in der Annahme, er sei in Paris. Er begegnet der gerade fertigen Abiturientin Liv auf dem Bahnhof Zoo und es war Liebe auf den ersten Blick. Den geplanten Strandurlaub mit Freundinnen trat Liv nicht an und brach für sechs Wochen alle Brücken hinter sich ab. Liv und Valentin – von nun an ein Paar, als sei es das selbstverständlichste der Welt. Valentin konnte zu Beginn natürlich kein Wort deutsch und wiederholte lautmalerisch immer die letzten drei Wörter Livs. Torik erzählt dieses zur-Sprache-kommen – wie so vieles in diesem Roman – in Parataxen: Liv lachte. Valentin lachte auch. Liv nickte mit dem Kopf oder sie schüttelte ihn, je nach Valentins Aussprache. In beiden Fällen lachte sie dann. Sie lachten häufig. In den ersten Tagen und Wochen sagte Liv oft nur drei Worte. Die konnte man gut an den Fingern abzählen. Später gingen sie zu komplexeren Strukturen über. Aus Worten wurden Wortreihen und daraus wurden Sätze. Es kamen abstrakte Gegebenheiten dazu. Diese Form des Erzählens hat zuweilen etwas Mechanisches, Kaltes. Und nicht nur der Duktus erinnert von Ferne an die frühe Marlene Streeruwitz.
Die Sekunde der wahren Empfindung?
Man kann ein Leben auf einer einzigen Sekunde aufbauen resümiert Liv nach mehr als 20 Jahren Zusammenleben und Ehe mit Valentin und diese Sekunde am Bahnhof, als sie den Mann aus dem osteuropäischen Dorf erblickte, war es denn auch die ihr Leben umkrempelte. Diese sechs Wochen des puren Zusammenseins – die glücklichste Zeit im Leben der beiden? Nach einer Seite heißt es als Zwischenfazit lapidar: Sie lebten seit beinahe fünf Wochen in dieser Ein-Zimmer-Wohnung. Man muss nicht Voyeur sein, um die Erzählung des Zaubers dieser ersten Wochen zu vermissen. Dafür gibt es Einblicke in den eher tristen Alltag der folgenden Jahre. Schließlich bekommt Valentin mit dem Erwachsenwerden der Tochter seine Midlife-Krise, besorgt sich ein Haus und baut es um zu einem Bordell – mit Unterstützung Livs. Die Ehe blüht in der Planungszeit neu auf um dann nachher wieder in der Normalität zu versinken. Weitere fünf Jahre später will Valentin das Edelpuff von Berlin nach Mărginime verlegen, kehrt in sein Heimatdorf zurück und Liv fühlt sich verlassen.
Rumänische Provinz versus Berlin – (Heimat-)Dorf versus große Welt: Toriks Buch spielt mit diesen Gegensätzen. Einerseits fühlen sich die Protagonisten wie magisch von Großstädten und deren (vermeintlichen) Möglichkeiten angezogen. Andererseits bleiben sie in ihren Ursprüngen verhaftet. So entstehen Unbehaustheiten und Unzufriedenheiten; ein Hin- und Herpendeln zwischen den Welten. Es gibt eine Passage im Buch, die die Faszination für die Großstadt illustrieren soll. Torik stellt ein Liebespaar im Berliner Regen (später stellt sich heraus, dass es sich um eine inszenierte Filmaufnahme handelt) und plötzlich wird der Moloch Berlin durch seitenlange Aufzählungen zum unbegrenzten (und unfassbaren) Möglichkeitsraum. Straßennamen, Stadtteile, Gebäude, Behörden, Seen, alle möglichen Arten von Geschäften, Cafés und Restaurants werden aufgezählt, als wären die flirrenden Großstadterzählungen noch nicht geschrieben. Es soll wohl Simultanität und Vielfalt, aber auch Verwirrung und Überforderung ausdrücken. Dagegen stehen die zuweilen mystisch-bedrohlichen Dorfschilderungen (wie beispielsweise im eindrucksvollen Kapitel über Clara, die als neue Lehrerin in Mărginime die gegenteilige Bewegung – von der Stadt in das Dorf – macht). Während die Dorferzählungen durchaus stimmungsvoll geraten, wirkt der Versuch, durch Addition von Orten und Örtlichkeiten eine Großstadtatmosphäre herbeizuphantasieren, arg bemüht.
Gelungener das Kapitel des scheinbar vergeblichen Wartens Leonies auf den blinden Mann, dem sie einmal kurz auf der Straße begegnet war. Sie hatte ihn nicht angesprochen und er war plötzlich enteilt. Also setzt sie sich in das gegenüberliegende Café, schaut auf die Straße und hofft, ihn wiederzusehen. Parallelen zu Liv, ihrer Mutter, deuten sich da an: Auch sie krempelt ihr Leben innerhalb einer Sekunde um. Sie nimmt ihren Urlaub und wartet. Leonie verbringt Wochen in dem Café und erwehrt sich schweren Herzens den Umgarnungsversuchen eines virilen Kellners, den sie nur in ihrer Phantasie beschläft und dabei eine anrührende Treue dem Unbekannten gegenüber offenbart. Ein tägliche[s] Warten und Hoffen. Und natürlich gibt es ein gutes Ende (der Leser weiß das aus den Anfangskapiteln; es geht in diesem Roman nicht darum, im Plot einen Spannungsbogen über den Fortgang von Ereignissen zu erzeugen), allerdings erst als sie die Suche aufgab (von einer Sekunde auf die andere). Da fand sie den blinden Mann, Marijan, durch Zufall in einer ganz anderen Gegend wieder. Die nachfolgende Liebesgeschichte wird in zwei unterschiedlichen Versionen erzählt (wobei es auch möglich ist, dass es sich um zwei unterschiedliche Zeitebenen handelt).
Puzzlespiel
28 Kapitel hat das Buch. Fünf davon tragen den Namen des Romans – es sind Eindrücke und die Rede des blinden Photographen Marijan bei einer Vernissage seiner Photographien in Berlin. Mit ein bisschen Phantasie lassen sich die anderen Kapitel als Reflexionen lesen, die ihm während dieses Ereignisses überkommen. Chronologie und Erzähler wechseln in diesem Buch sehr häufig; neben einem personalen gibt es verschiedene Ich-Erzähler. Zwar wird das Marijan-Ich in Anführungszeichen gesetzt und damit sozusagen öffentlich zitiert, auf irgendwie geartete sprachliche Differenzierungen der diversen Erzähler jedoch weitgehend verzichtet. Fast immer werden die bereits erwähnten Hauptsätze verwendet. All dies fördert, ja fordert, das Forschen des Lesers: Wer spricht dort? Wann spielt das jetzt? Manchmal kann man sich die Lösung erst in der Mitte eines Kapitels zusammenreimen und gerät dann ins Blättern – wenn man sich nicht vorher genaue Notizen gemacht hat.
Es darf keine Frage der Neigung sein, ob dieses postmoderne Puzzlespiel goutiert wird oder nicht. Es ist zu unterscheiden, ob Rückblenden durch das Erzählen sozusagen erzwungen werden, ob es sich ergibt (in Form einer Reflexion eines Protagonisten) und damit einen epischen Bogen spannt oder ob es nur Camouflage ist, die dem Leser eine eher laffe Speise würzen soll. Zugegeben, der vorliegende Roman ist sehr genau konzipiert, aber mag man eigentlich derart absichtsvoll durchkonstruierte Prosa? Man kann zu sorgfältig planen, zu gewollt Zeitebenen einschieben und dabei zu deutlich auf das pure Erfolgserlebnis des Lesers bauen, das Teilchen an die vermeintlich richtige Stelle eingeordnet zu haben. Entscheidend für die Beurteilung eines solchen Verfahrens muss sein, ob es eine poetische Ernte gibt, eine durch das Konstruktionsprinzip eintretende Erkenntnis oder nur launige Verwirrung. Ich fürchte, es handelt sich zumeist um Letzteres.
Auch das Thema der abwesenden, eher: verschwundenen Krisztina wird fast leichtfertig verschenkt. Da erzählt Torik an einer Stelle von der dauerhaften und noch nach Jahren zehrenden Trauer der Eltern ob der Ungewissheit des Schicksals ihrer Tochter (in teilweise wunderbaren Sentenzen). Und auch die Selbstvorwürfe und Vermutungen anderer Dorfbewohner werden immer eingestreut. Aber am Ende wird gerade in der absichtsvollen Ungewissheit zwischen der Möglichkeit eines bisher unerkannten Verbrechens oder einfach nur dem radikalen Bruch mit Familie und Freunden das Gegenteil von Empathie erzeugt. Zumal die Figur Krisztina kaum Konturen hat, außer, dass sie als wunderschön gilt und Lehrerin werden wollte. So wird der Leser schließlich in eine Art Gleichgültigkeit überführt und nachträglich fast peinlich berührt von den Trauernden und Vermissenden. (Das Argument, dass es durchaus solche »Fälle« gebe und die Ungewissheit nie aufhöre, mag nur demjenigen kommen, der in Literatur einen Realismus gespiegelt sehen möchte.)
Ambivalent ist die Ausgestaltung der Figur des blinden Photographen Marijan. Das Vorbild ist (in mehrfacher Hinsicht) natürlich der Slowene Evgen Bavcar. Marijans Prozess der Blindwerdung und die anschließende Blindenschule werden von ihm ergreifend erzählt. Man glaubt für einen Augenblick an sich selber zu bemerken, wie verkümmerte Sinne wieder »freiwerden«. Mit dem genauen Zuhören auf den Ton eines Metronoms, wie sich der Schall des Metronom-Tones in dem Raum waagrecht und senkrecht…verteilte und sich die winzige[n] Differenzen in den Tönen zeigte, erhalten Marijan und mit ihm die anderen Teilnehmer der Blindenschule einen synästhetischen Schub, der sie aus einer veritablen depressiven Stimmung befreit: Wir nahmen nichts anderes wahr als eben diese Blindheit. Aber das war falsch. Wir mussten das Gegenteil lernen, die anderen Sinneserfahrungen so auszuweiten, dass sie den Verlust der einen leichter machten…Wir wollten so bleiben wie wir waren, aber wir mussten uns verändern! Zu diesen Veränderungen gehörte eben die Veränderung in der Wahrnehmung von Klängen. Ein Gefühl für den Raum, der einen umgab, für seine Dichte und seine Elastizität. Ein Gefühl für den Druck der Luft. Schließlich konnten sie die Größe der Gegenstände hören – und niemals mehr wird man so etwas wagen, anzuzweifeln. (Etwas ärgerlich dann, dass die Autorin ein ohnehin auf der Hand liegendes »Geheimnis« in Verbindung mit der Blindenschule später lüftet.)
Marijan zieht mit seiner Mutter nach Berlin. Er festigt sich, aber der Unfalltod seiner Mutter Jahre später erschüttert das zarte Geflecht zwischen ihm und der Welt; eine bleierne Müdigkeit bemächtigt sich ihm: Die Blindheit lastete schwerer auf mir als sonst. Ich geriet in eine Stimmung, in der ich schon einmal gewesen war: in der Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt. Mein Leben schien mir nicht lebenswert. Ich spielte mit der Vorstellung, es aufzugeben. Hier glückt die Darstellung der Abwesenheit (der tödlich verunglückten Mutter), weil die abwesende Person und besonders deren Anwesenheit eine Geschichte hatte. Marijan überwindet diese Krise in dem er beginnt, Kontakt mit den Nachbarn zu suchen. Er entdeckte einen Park. Die Selbstbehauptung gelingt und dies nachvollziehbar. Trotzdem wird dann – leider – der Photoapparat ins Spiel gebracht und die Bavcar-Parallele aufgepfropft. Vielleicht, weil die Autorin noch etwas aus dem Künstlermilieu einbauen wollte?
Am Ende fällt die Figur auseinander. Als Liebender und im Verhältnis zu Leonie schlüpft Marijan in eine eher passive Rolle. Wie steht es denn nun mit seinen Wahrnehmungen? Fast scheint es, als seien sie abhanden gekommen oder hätten sich abgeschliffen. Die Vermarktung von Marijans Photographien übernimmt Leonie bzw. der Galerist. Und wie photographiert Marijan nun? Bavcar hat davon ausführlich Zeugnis abgelegt (nicht immer völlig überzeugend, etwa wenn er nicht auf sein Blindsein reduziert werden möchte, zugleich jedoch sein Künstlertum damit derart stark verbunden ist). Die Möglichkeit der Reflexion über die Paradoxie des Photographierens eines Blinden – und die damit verbundene Reduzierung auf das Faktum des Blindseins – findet bei Marijan kaum statt (fast scheint es so, dass er dazu intellektuell nicht in der Lage ist).
Personal und Dialoge
Insgesamt ist das Personaltableau ausufernd und einige interessante und potentiell vielschichtige Figuren werden vernachlässigt. Da gibt es beispielsweise einen Maddox, der seinen Mund schonen möchte. Daher spricht er nicht, sondern simuliert mit zwei Gebissen – eines in der rechten und eines in der linken Hand. Damit »spricht« er – sowohl zu sich selber als auch zu anderen Menschen. Das ist zunächst einmal witzig und originell und man kann mit viel Wohlwollen auch eine gewisse Metaphorik erkennen, aber am Ende verbraucht sich der Effekt, alles ist seltsam possierlich und man fragt sich, welchem Zweck diese Figur dient außer vielleicht zur Verminung des Bedeutungsraumes.
In manchem Dialog wirken die Sprechenden wie Simulanten ihrer selbst. Die Protagonisten nehmen eine ihnen zugedachte Pose ein und spielen eine Rolle, die von der Autorin zugewiesen wurde, aber der Figur nicht gemäß ist (was zunächst paradox klingen mag, da ja auch die Figuren künstliche Existenzen sind). Es entsteht eine spezielle Form einer (Meta)Künstlichkeit, die, jegliches Pathos bannend, »natürlich« wirken soll, d. h. »realistisch« daherkommen möchte. Zu oft wird dabei der Ton handelsüblicher Ratgeberliteratur gestreift (»Man geht, bis man angekommen ist, und man ist angekommen, wenn man mit dem Gehen aufgehört hat«). Und einige Dialoge erinnern an TV-Soaps (»Schöner Name, den du da hast. Steht dir gut« oder »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, sagte ich wahrheitsgemäß).
»Das Geräusch des Werdens« ist bei aller Kritik ein lesenswertes Buch. In jedem Fall hat sich ein beachtenswertes schriftstellerisches Talent gezeigt. Dabei ist es eigentlich (zunächst) uninteressant, ob die Biographie der Autorin (oder ist es ein Autor?) erfunden ist oder ob es sich um eine Kunstfigur handelt, wie jemand mit klebrigem Ehrgeiz und viel enttäuschter Liebhaberei behauptet. Vielleicht wollte Autor und Verlag eine besondere Authentizität erzeugen und eine Legende begründen, dessen ein mündiger und genauer Leser (letzteres ist ein Pleonasmus) eigentlich nicht bedarf. Aber eine gewisse Lesefuttergemeinde hübscht damit ihr interkulturelles Panoptikum auf und ein kleines Skandälchen kann schließlich jeder Roman gebrauchen. Wenn sich die Person, die sich Aléa Torik nennt (und vielleicht nicht ursprünglich aus Rumänien sondern aus Buxtehude kommt), nun noch auf das Erzählen konzentriert und die am Horizont (bedrohlich) aufkommende »Neue Subjektivität« der 1970er Jahre zu bannen vermag, ist noch einiges zu erwarten.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.
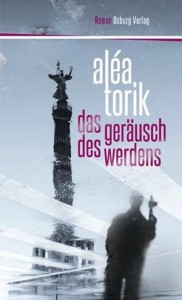
Womöglich ist der Autorenname Programm?
@Ralph
Im Sinne der Definition in dem Link ist fast das Gegenteil der Fall: Das Buch ist fast akribisch durchkonstruiert, was man im deutlich bemerkt (hierin liegt ja mein Problem).
Die Autor/in diskutiert auf ihrem Blog mit Lesern. (So etwas sollte man mit Vorsicht genießen.)
»Als enttäuschter Liebhaber mit klebrigem Ehrgeiz aus der Lesefuttergemeinde« halte ich Ihre Rezension für durchaus gelungen. Die diagnostizierte Überkonstruktion resultiert allerdings meines Erachtens gerade aus der nur fingierten Autorschaft. Wie soll denn bitte Authentizität im Aleatorischen entstehen, wenn der Autor seine Figuren und die Leser gleich mit als Schachfiguren begreift? Die literarische Gattung »Roman« hat immer auch Reibung an einer empfundenen Realität zur Aufgabenstellung. Dieses Buch und auch das folgende hätte mit »Es war einmal...« anfangen müssen, denn die Ebene, auf der hier konstuiert wird, ist die eines Märchens. Die Figur des Autors selbst ist zum Märchen geworden, das er (!) in Berlin, nicht in Buxtehude, seiner Lesefuttergemeinde erzählen will. Die Subjektivität der siebziger Jahre war dagegen purer Realismus. Nichtsdestotrotz, da haben Sie auch wieder recht, bleibt nur das Warten auf das neue Märchen. Damit macht Godot dann sein Endspiel, denn der Autor meint, er hielte wie Gott alle Fäden in seiner genialen Hand.
Die Autorenschaft hat mit der Konstruktion dieses Romans nichts zu tun, weil Torik dies gar nicht thematisiert (wie das beispielsweise Pessoa teilweise mit seinen Heteronymen macht [bitte nicht glauben, ich vergleiche A.T. mit Pessoa]) .
Bei der Forderung nach »Authentizität« ziehe ich – salopp gesprochen – immer sofort den Revolver, weil es nichts lächerlicheres gibt, als dies für eine fiktionale Geschichte sozusagen einzufordern. Dass es dennoch als eines der wichtigsten Kriterien gilt hat hauptsächlich damit zu tun, dass die zeitgenössische Literaturkritik kaum noch ästhetische Urteile wagt und sich daher lieber auf Rückbezüge auf den/die Autor/in stützt. Das ist im Zweifel einfacher und verspricht Faktenanalysen, wie sie bei der reinen literaturkritischen Analyse sehr schwer möglich sind. Es ist auch massentauglicher. (Im Rahmen eines kürzlich begangenen Jubliläums fällt mir dazu Karl May sein – der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung seiner Abenteuergeschichten trotz entgegenstehender Aussagen die entsprechenden Regionen gar nicht kannte. Dies machte man ihm dann zum Vorwurf.)
Noch interessanter als eine fingierte Autobiographie ist im Rahmen der Boulevardisierung des Feuilletons natürlich das ausdrückliche Schreiben unter Pseudonym, welches geheim bleibt. Dazu gibt es zahlreiche Beispiele. Reizvoll ist es dann über die Identität zu spekulieren – darüber wird gerne die Auseinandersetzung mit dem abgelieferten Text vergessen bzw. nivelliert.
Pingback: “Das Geräusch des Werdens” « Lafcadios Go-Ecke
Äußerst interessante Diskussion bei Phorkyas (s. auch »Pingback«).