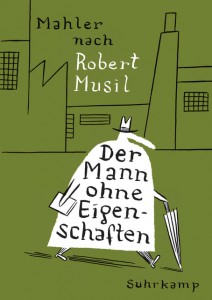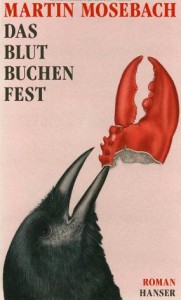Vor einigen Wochen wurde auf Nachfrage meinerseits wie dieser Blog hier zu verbessern ist, angeregt eine Art Leserunde zu veranstalten. Ich gestehe nun, dass ich skeptisch bin, was das Lesen und Kommentieren in Teilen oder Kapiteln angeht. Man kann anderen schwerlich ein Lesetempo vorschreiben; unweigerlich gibt es Teilnehmer, die schon weiter sind und dann von Kommentaren gelangweilt werden, usw. Der zweite Grund meiner Skepsis ist, dass ich das Buch nicht zur Verfügung stellen kann, d. h. die potentiellen Mitmacher müssten es sich auf eigene Rechnung kaufen.

Martin Gessmann:
Mit Nietzsche im Stadion
Ungeachtet dieser Probleme möchte ich dennoch versuchen, eine solche Leserunde einzurichten. Hierfür bietet sich die Fußball-WM an und durch Herbert Debes von »Glanz und Elend« habe ich meines Erachtens ein Buch gefunden, dass sich zu lesen und zu diskutieren lohnen könnte. Es ist das Buch von
Martin Gessmann mit dem Titel »Mit Nietzsche im Stadion – Der Fußball der Gesellschaft«, Wilhelm-Fink-Verlag, 143 Seiten, EUR 16,80 (in D).
Gessmann versucht Parallelen von Fußballsystemen und Gesellschaftssystemen herauszuarbeiten. Er findet aktuell drei Fußballsysteme der Moderne, die das alte, eher autoritäre Libero-Spielsystem seit den 1970er Jahren abgelöst haben. Diesen Systemen ordnet er soziophilosophische Begriffe zu. Stark vereinfacht sieht dies so aus:
Liberalismus -> im weitesten Sinne an Thomas Hobbes anknüpfend; defensiv (wie der Staat in Liberalismus); individualistisch; ergebnisorientiert -> Mourinho
Republikanismus -> an den Idealen Rousseaus erinnernd; mannschaftsdienlich, fast kollektivistisch; Dominanzfußball; strategisch -> Guardiola
Ästhetizismus -> nietzscheanisch; hohes Risiko eingehend; hohe Laufbereitschaft; notfalls »in Schönheit sterbend« -> Klopp
Die Systematik ist von mir sehr grob aus dem Text formuliert und basiert auf der Einleitung; der ersten 30 Seiten. Ich selber habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, finde es aber diskussionswürdig und sehr interessant. Was übrigens nicht bedeutet, dass ich mit allem übereinstimme. Gessmann weist auf eine früheren Text von ihm über Fußballsysteme hin und gibt zu, sich damals teilweise geirrt zu haben. Vielleicht kennt einer dieses Buch; ich habe es nicht gelesen.
Mein Vorschlag zur Leserunde: Ich bespreche das Buch am 02. Juni in diesem Blog. Von da an können dann die Kommentare beginnen. Sollte jemand Interesse haben, das Buch vorher zu besprechen, würde ich ihm gerne hier den Raum zur Verfügung stellen. Dann würden mehrere Deutungen zur Diskussion stehen.
Wenn möglich, bitte Interesse in den Kommentaren anmelden. Natürlich auch, wenn es Vorschläge gibt.
PS: Nein, das ist KEINE Promotionmassnahme des Verlages; ich bekomme dafür kein Geld.
Hier geht’s dann zur Leserunde (ab 02.6.)