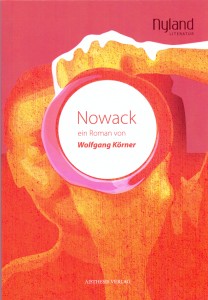Wie Josef Winkler seinen Erinnerungskosmos erweitert
»Requiem für einen Vater« untertitelte Josef Winkler seine Erzählung »Roppongi« aus dem Jahr 2007. Auf einer Vortragsreise in Japan erfährt der Ich-Erzähler, der große Ähnlichkeiten mit Josef Winkler besitzt, vom Tod seines Vaters, jenem über- und allmächtigen »Ackermann aus Kärnten« mit dem Winkler in seinen Büchern, vor allem in den ersten Romanen, wuchtig, expressiv und anklagend grollte. Der Vater symbolisierte Enge, Archaik und Stumpfsinn, atemlos wird eine schreckliche Kindheit und Jugend aus dem schrecklichen Dorf Kamering in Kärnten in den 1950er/1960er Jahren erzählt. Der »Ackermann aus Kärnten« wurde zum Archetyp für eine ganze Region, eine ganze Epoche. Auffallend in »Roppongi« war aber die Milde mit der Winkler erzählte, eine Milde, die zwar die Schrecken der Kindheit und Jugend immer wieder blitzartig aufleuchten ließ, aber am Ende dann doch vor dem 99jährigen Toten (Jahrgang 1905) den Respekt nicht versagte. Der Ich-Erzähler seiner Bücher hatte sich von seinem Leiden emanzipiert, losgeschrieben und konnte damit nun vorurteilsfreier auf seine Figuren blicken und, in Grenzen, ihre Motivationen erforschen. Die Expressivität verschwand nicht, wurde aber aufgefüllt mit anekdotischem. Dahinter durchaus spürbar: die Furcht, der Fluch des Vaters, nach seinem Tod könne er, der Sohn, nicht mehr schreiben, weil er niemanden mehr habe, über den er schreiben könne, könnte sich vielleicht erfüllen.
Sechs Jahre später leuchtet Winkler eine weitere Facette seines Kindheit und Jugend aus, die im Titel schon anklingt: »Mutter und der Bleistift«. Wie so manches Winkler-Buch ist auch diese knapp 60seitige Erzählung ein Triptychon. Vorangestellt ist ihr als eine Art Prolog eine kleinere Erzählung (30 Seiten) mit dem Titel »Da flog das Wort auf«. Mit Zitaten von Ilse Aichinger wird eine düstere Welt evoziert, die nach den Schrecken des Krieges (die Großmutter mütterlicherseits versank in Apathie, als sie kurz hintereinander die Botschaft erreichte, dass drei ihrer Söhne – 18, 20 und 22 Jahre alt – im Krieg »gefallen« waren) nicht mehr gottes- sondern satansfürchtig wurde und (für Winklersche Verhältnisse) früh mit 60 Jahren an »gebrochenem Herzen« starb.
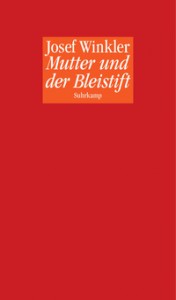
Mutter und der Bleistift