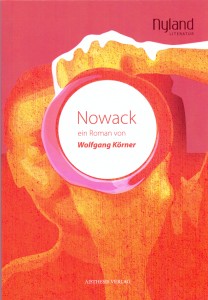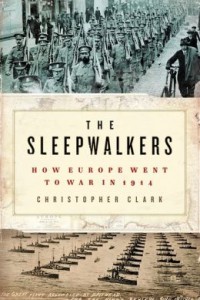Ablenkung
Unabweisbar ist die Strukturähnlichkeit zwischen dem digitalen Windowing und jener Modekrankheit, die man abkürzend und von den Dingen ablenkend als ADHS bezeichnet. Leute aus meinem Bekanntenkreis, die an systematischen Aufmerksamkeitsstörungen und zugleich an Hyperaktivität leiden, gehen in ihrem Alltag häufig an einen Ort (zum Beispiel in der Küche oder auf dem Balkon) und erinnern sich, wenn sie ankommen, nicht mehr, was sie dort eigentlich wollten. Notgedrungen gehen sie weiter an den nächsten Ort, aber dort geschieht ihnen das gleiche. Sie können sich nicht an das erinnern, was sie vorhatten, und oft auch nicht an das, was sie kurz zuvor getan haben. Auch das Vergessen eines Plans oder Planelements ist im Grunde genommen ein Vergessen von seit kurzem Vergangenem. Ganz ähnlich verhalten wir uns, wenn wir »surfen«: Ziemlich rasch vergessen wir, wohin wir »eigentlich« wollten und was wir dort zu suchen hatten. Wer vorsätzlich surft, etwa zu Unterhaltungszwecken, strebt diese Art des Vergessens an. Für Menschen, die unter ADHS leiden, sind diese Symptome allerdings kein Vergnügen, sondern eben Störungen, die sie an einem halbwegs befriedigenden Leben hindern können.
Das Wort »Modekrankheit« ist ungerecht, es klingt verächtlich. Besser, ich nehme es zurück. Anscheinend hat aber jede Zeit bestimmte Krankheiten, die ihre gesellschaftlichen Widersprüche und Gebrechen auf individueller Ebene ausdrücken. Insofern wird man vielleicht behaupten können, daß ADHS die Krankheit des digitalen Zeitalters sei. Weiterlesen