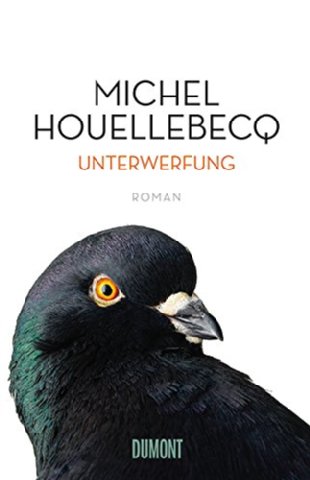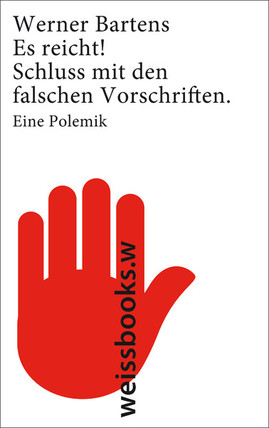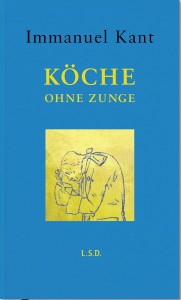Nach mehr als zwanzig Jahren lädt der unkonventionelle Deutschlehrer Thorsten Korthausen – von Ferne erinnert er an John Keating aus dem »Club der toten Dichter« – seinen einstigen Musterschüler Arnold Litten zu einer kleinen Party nach Hause ein. Arnold ist inzwischen ein angesehener Germanistik-Professor. Auf der Fahrt erzählt er seiner Freundin Anna die Besonderheiten und Extravaganzen Korthausens. Zum Beispiel dessen erste Deutschstunde in der Privatschule für »ausnahmebedürftige Schüler«, dieser »Ansammlung von Aufsässigkeit und Lustlosigkeit«. Niemand nahm den neuen Lehrer zur Kenntnis. Schließlich beteiligte dieser sich an einer Schachpartie, die während des Unterrichts gespielt wurde. Ein vergnüglich zu lesender Anekdotenstrauß prasselt da auf den Leser ein. So wird von Korthausen eine Klassenarbeit Arnolds mit »Eins bis Sechs« benotet – weil sie sowohl sehr gute wie auch ungenügende Passagen enthält. Ein andermal dann mit »Eins plus plus«. Oder die Sache mit dem Hund: Korthausen erzählt Wunderdinge von seinem Hund, den er eines Tages mitbringt und die Aufsicht bei einer Klassenarbeit vornehmen lässt. Der Hund sei aggressiv und belle sofort wenn geschummelt würde. Die Schüler sind eingeschüchtert und wagen keine Manipulationen. Am Ende eröffnet Korthausen ihnen, dass er den Hund aus dem Tierheim geholt habe. Oder dieser Schüler, der in vielen Fächern Fünf stand und dann Vieren bekommt, weil er mit Korthausen einen strammen Waldlauf durchsteht.