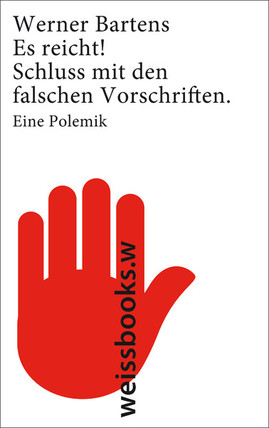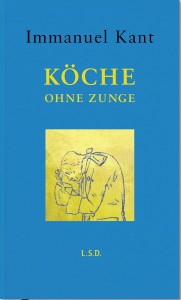Herrn Dr. Gniffke, seines Zeichen 1. Chefredakteur bei »NDR/ARD Aktuell«, reicht’s! In einem Blogeintrag poltert er aus seiner Nachrichtenhöhle gegen diejenigen, die das Bild der marschierenden Politiker in Paris als Inszenierung apostrophieren. Jedes Politikerbild sei eine Inszenierung, so Gniffke. Und im übrigen verwahrt er sich gegen jene, die diese Nachrichtenfälschung als solche benennen, wie zum Beispiel Ines Pohl.
Die Taktik ist nicht ganz neu, allerdings die Rhetorik. Die Dünnhäutigkeit bei Journalisten scheint ausgeprägt zu sein; sie sind nicht gerne selber Gegenstand der Berichterstattung, sondern teilen lieber aus. Gestern wurde »Lügenpresse« zum »Unwort des Jahres« ernannt, da glaubte Gniffke sich vielleicht unbesiegbar. Bis jetzt haben sich 295 Kommentare zum Blogeintrag eingefunden – durchaus etliche darunter, die ihm zustimmen. Eine Diskussion entsteht dennoch nicht, weil sich die Redaktion – wie vorher auch schon – zuverlässig verweigert.
Gniffkes Kernthese: Jedes Politikerbild ist per se eine Inszenierung – also braucht man sich auch nicht wundern, wenn dieser Trauermarsch eine solche ist. Der Unterschied ist nur, dass die »normalen« Politikerinszenierungen als solche sichtbar und für den Zuschauer mindestens erahnbar sind. Ausschnitte aus Pressekonferenzen, die fast schon ritualisierten Opposition-hat-auch-etwas-zu-sagen-Statements (maximal ein Satz; manchmal nur ein halber), diese unseligen wie nichtssagenden Bilder von »Gipfeln« oder Staatsbesuchen – all diese Inszenierungen sind längst zum ikonografischen Bestandteil von Nachrichtensendungen geworden. Man könnte es ein bisschen rustikal ausdrücken: Niemand glaubt mehr, dass es hier um die Vermittlung in der Sache geht – es sind Sprachspiele, die notgedrungen bebildert werden (müssen); leider immer mehr bewegt und mit O‑Tönen statt als Standbild und von einem neutralen Sprecher vorgelesen. Weiterlesen