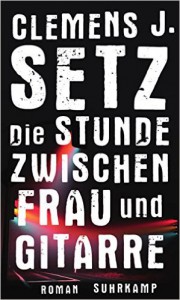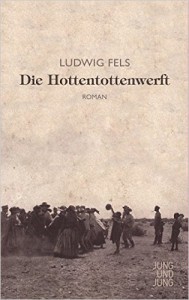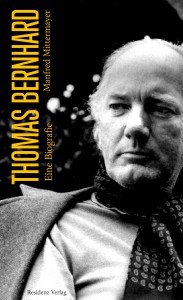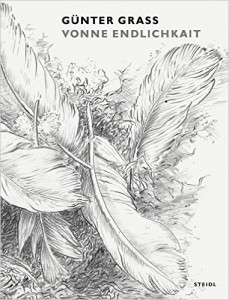Zunächst war der in den 1970er Jahren aufkommende Begriff der »Neuen Innerlichkeit« für die damals neu entstehende deutschsprachige Literatur gar nicht als Schimpfwort gedacht. Ausgedrückt werden sollte damit die Abgrenzung von einer politisch motivierten und moralisierenden Literatur, die insbesondere in den 1960er Jahren dominierte. So wurden die ersten Texte, die das Subjekt mit ihren persönlichen, existentiellen Deformationen in das Zentrum rückten, zunächst vorsichtig begrüßt. Aber es dauerte nicht lange, bis das Rubrum »Innerlichkeit« pejorativ verwendet wurde: Eitle Selbstbespiegelung, Seelenstriptease, unpolitisch, restaurativ – oder knapp formuliert: langweilig und narzisstisch. Dabei ist es eigentlich bis heute geblieben. Immer noch gilt Innerlichkeitsprosa als verdächtig, wenn sie fast ohne Plot daherkommt oder sich nicht notdürftig mindestens als Entwicklungsroman tarnt. Merkwürdigerweise keine Probleme gibt es mit den Innerlichkeiten der Hauptfiguren im Kriminalgenre, wie beispielsweise in den inzwischen längst als Literatur kanonisierten Kriminalromanen des kürzlich verstorbenen Henning Mankell. Die Lebensprobleme seiner Hauptfigur Wallander werden gleichrangig mit dem zu lösenden Kriminalfall behandelt. Dabei käme niemand auf die Idee, Mankells Wallander-Romane als Innerlichkeitsprosa zu verorten. Tatsächlich gelten sie als »authentisch« und damit wird einer der aktuellen Feuilletongötzen gehuldigt: Literatur hat sich einem Realismus zu verpflichten. Nur das Fantasy-Genre und literarische Dystopien sind von diesem Gesetz befreit (was deren Erscheinungsmenge erklärt).
Der mediale Erfolg von Clemens J. Setz’ »Die Stunde zwischen Frau und Gitarre« liegt womöglich darin, dass er eine Innerlichkeitsprosa anbietet, die im Tempo und Zeitgeist der Gegenwart daherkommt und zusätzlich noch eine Suspense-Handlung eingebaut hat. Die Hauptfigur ist die 21jährige Psychiatrie-Betreuerin Natalie Reinegger. Erzählt werden (bis auf die wenigen Seiten Epilog, der zwei Jahre später spielt) sieben oder acht Monate im Leben dieser jungen Frau, die in einer psychiatrischen Anstalt (Euphemismus: »Betreutes Wohnen«) eine neue Stelle beginnt. Das Setting kommt daher wie ein Kammerspiel; vier Betreuerinnen, ein, zwei »Zivildiener«, eine Handvoll Bewohner. Weiterlesen