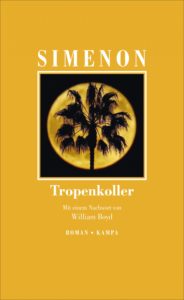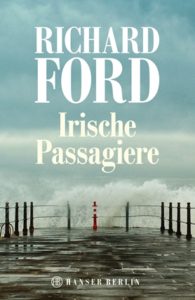Jenseits der Literatur
Die sogenannten Oxford Lectures am St. Anne’s College gibt es seit 1993. Es sind Einladungsvorlesungen, in denen im weitesten Sinn interdisziplinär über Literatur und deren Bedeutung reflektiert werden soll. Fachleute nennen das »Komparatistik«. George Steiner und Umberto Eco gehörten zu den Vortragenden wie auch Amos Oz, Mario Vargas Llosa und Bernhard Schlink (der auf der Webseite »Bernard« heißt). 2019 wurde diese Einladung Durs Grünbein zuteil. Die vier Vorlesungen liegen nun als Buchform vor, was bei den Vorlesungen anderer Autoren bisher eher selten der Fall war.
Der Titel »Jenseits der Literatur« ist, wenn man am Ende alles gelesen hat, einleuchtend. Er ist programmatisch. Der interdisziplinäre Ansatz wird von Grünbein voll ausgereizt. Zwischenzeitlich hat man eher das Gefühl in einem Geschichtsseminar zu sitzen. In der ersten Vorlesung erinnert sich Grünbein an die Hitler-Briefmarken, die er einst in seinem Briefmarkenalbum sortiert hatte. Es gab sie in vielen Farben, je nach Wert. Bereits damals stellte sich eine Mischung aus Gruseln und Ehrfurcht ein. Er erzählt kurz von einem Madelaine-Erlebnis, wenn er Briefmarkenalben heute sieht um dann über die Marketing- und Werbestrategien der Nazis zu reflektieren. Dann wird von einem gewissen Edmund Kalb erzählt, einem österreichischen Maler, er in einer wilden Mischung aus Querulanten- und Idiotentum seinen persönlichen Widerstand leistete, dafür ins Gefängnis kam und trotzdem, wie durch ein Wunder, überlebte. Kalb ist für Grünbein ein Bartleby, der Schreiber aus Melvilles Novelle (»I would prefer not to«).
Der Maler versuchte mit seiner Familie autark zu leben, vom Anbau in seinem Garten, veredelte erfolgreich Bäume. Er genoss das Gefängnis, solange er seine Ruhe hatte. Nach dem Krieg änderte er sich nicht. Grünbein liest seine Tagebuchaufzeichnungen: »Einmal auf dem tiefsten Grund der Irritation, hält er den Gedanken fest: daß die vielfältigen Gefühle, die einem beim Wahrnehmen der Welt begleiten, nie im Worten auszudrucken sind – sondern allenfalls, hin und wieder mit etwas Glück, mit Hilfe von Zeichnungen.« Gefühlserlebnisse seien, so Grünbein Kalb zitierend, nicht an andere »zu übertragen und aufzubewahren.« Sie seien jenseits der Literatur. Damit sind die Koordinaten für die weiteren Texte vorgegeben.