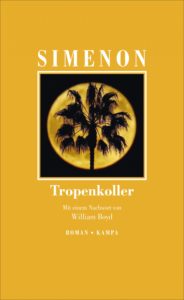
Tropenkoller
Im Original heißt der Roman eigentlich »Le coup de lune«, also ungefähr »Mondstich« – im Deutschen hingegen zunächst »Tropenfieber«, dann »Tropenkoller«. Vielleicht würde man das Buch anders lesen, wenn der eher mystische Originaltitel präzise übersetzt geworden wäre. Aber die mit dem deutschen Titel verbundene Entmystifizierung ist eigentlich ganz gut.
Simenon hatte den Roman binnen kurzer Zeit – also wie immer – 1932 nach einer Reise durch das koloniale Afrika für ein französisches Magazin geschrieben. Der schottische Schriftsteller William Boyd weist in seinem kundigen Nachwort zu Recht darauf hin, dass man dieses hastige Entstehen dem Roman anmerkt. Es gibt Abschweifungen von der Geschichte, die ins Nichts verlaufen und bisweilen eine stark dramatisierende Sprache. Am stärksten hat mich die Ungereimtheit gestört, dass gegen Ende die Hauptfigur Joseph Timar plötzlich einen Revolver in der Tasche hat und niemand genau weiß, wie der da hergekommen ist.
»Tropenkoller« ist aber nicht nur in diesem Punkt ein typischer »roman durs« von Georges Simenon, also ein Roman ohne seinen legendären Kommissar Maigret. Eine Täterjagd gibt es nicht; um Spannung zu erzeugen braucht es keine Whodunnit-Konstruktion. Der Tathergang des Mordes an einen Schwarzen ist schnell mehr oder weniger klar; das Motiv wird früh präsentiert. Boyd weist darauf hin, dass die »Story« selber nicht das mitreißende ist. Dafür besitzt der Roman eine enorme atmosphärische Verdichtung der Stimmung im kolonialen Gabun der 1930er Jahre, die enorme Hitze, die Gerüche, die Eintönigkeit des Lebens dort, die Lethargie der Protagonisten. Und vor allem geht es Simenon um die Ausgestaltung der Psyche (und der Physis) des 23jährigen Joseph. Er stammt aus wohlhabendem Hause und wurde von seinem Onkel nach Libreville, Gabun, geschickt. Dort soll er in einem Unternehmen anfangen, aber man weiß dort von ihm nichts (ein Szenario ähnlich wie in »Die Schwarze von Panama«, ein paar Jahre später geschrieben). Die sofortige Rückreise nach Frankreich ist nicht möglich (oder nicht gewollt, das bleibt unklar).
Durchaus mit finanziellen Mitteln ausgestattet, quartiert er sich zunächst im »Hotel Central« ein. Das Publikum dort besteht aus Kolonialbeamten, Holzfällern und Kaufleuten – alles Weiße. Schwarze dienen als Personal. Noch glaubt er der Agenda: »Es gab insgesamt fünfhundert Weiße in Libreville. Leute, die ein hartes, manchmal gefährliches Leben auf sich nahmen, nur damit man in Frankreich begeistert von der Erschließung der Kolonien sprechen konnte.«
Die Wirtin Adèle Renaud führt dort eine harte Hand. Aber bereits in der ersten Nacht verführt die »füllige fünfunddreißigjährige Frau«, die stets nur ein schwarzes Kleid trägt, mit ihrer »dumpfe[n] Sinnlichkeit« Joseph. Tags darauf wird bei einem kleinen Fest unter dubiosen Umständen ein Schwarzer erschossen. Fast gleichzeitig stirbt der bettlägerige Mann von Adèle. Die Behörden agieren eher lustlos, um Zeugen für das Verbrechen zu vernehmen. Es ist eh klar: Niemand hat etwas gesehen. Joseph lernt die korrupte und träge Kolonialbürokratie kennen, denen die Bestückung ihrer Bar wichtiger ist als eine seriöse Ermittlung. Der Onkel ist dem Kommissar und sogar dem Gouverneur als ökonomische und politische Größe bekannt und hoch angesehen. Adèle entwickelt indessen Pläne mit Joseph: Im Landesinneren, weit entfernt von der Hauptstadt, möchte sie ein Gebiet pachten. Es gibt dort Tropenholz, welches lukrativ nach Europa verkauft werden kann. Mit 1 Million Francs binnen weniger Jahre könne man dann nach Frankreich zurück und dort sorglos leben. Joseph telegraphiert seinen Onkel an, der ihm die Möglichkeit eröffnet, das Grundstück zu pachten, während Adèle mit dem Verkaufspreis für das Hotel einsteigt. Die beiden brechen auf.
Es beginnt zunächst vielversprechend, aber Joseph quält sich mit Alkohol, dem in Schüben auftretenden Dengue-Fieber und noch mehr mit seiner Ahnung, dass Adèle den Schwarzen umgebracht hat. Überhaupt ist er von Beginn an starken Stimmungsschwankungen unterworfen. Unbehagen, Euphorie, depressive Schübe, Wahnvorstellungen und dann auch wieder Ruhephasen wechseln in immer schnellerer Folge ab. Simenon beschreibt detailliert jedes Aufkommen dieser Stimmungen, die oft keines besonderen Anlasses bedürfen. Hinzu kommen noch das tropische Klima und eine zunehmende, zehrende Eifersucht. Irgendwann ist ihm klar, dass Adèle irgendwann mit allen Honoratioren geschlafen haben muss und auch den Vorarbeiter im Holzbetrieb hat er in Verdacht. Jeder noch so kurze Absenz von Adèle macht ihn unruhig, fahrig. Joseph scheint mehrmals dem Wahnsinn nahe, aber Adèle kann ihn zunächst immer besänftigen. Eines Nachts stellt er sie zur Rede – und sie gesteht den Mord.
Jetzt auch noch das schlechte Gewissen. Kann er damit weiterleben? Am nächsten Morgen ist Adèle nicht da, sie ist nach Libreville zum Prozess gefahren. Adèle oder wer auch immer hatte für einen Schuldigen bezahlt: »Der Dorfälteste wählte denjenigen aus, den er am wenigsten leiden konnte«. Rasend in einer Mischung aus Eifersucht, Trotz und Liebe beschließt er ebenfalls aufzubrechen – in einem Ruderboot mit einem Dutzend Schwarzer.
Der Roman nimmt mit dieser Reise eine kleine Auszeit. Die Szenen mit den Schwarzen im Boot auf der nicht ganz ungefährlichen Reise sind fast episch geschildert. Joseph bekommt einen anderen Blickwinkel auf die Schwarzen, die ihm bisher nur als Sklaven erschienen waren. Ihre Kraft, ihre Gesänge, mit der sie traumwandlerisch das Boot sicher rudern und steuern, ihre Nacktheit, ihr Dasein in dieser Welt – alles imponiert ihm. Dazwischen er, der Weiße, der eigentlich nichts von ihnen weiß, dessen Machtinsignien Alkohol, Zigaretten und, vor allem, der Tropenhelm ist. Joseph ahnt zum ersten Mal: Er hat hier nichts zu suchen. Die gelungene Szene zerstört Simenon dann doch noch, in dem er Joseph während einer Rast mit einer schönen Schwarzen schlafen lässt und das mit allerlei Schwulst garniert.
Als er endlich in Libreville ankommt, beäugt man ihn argwöhnisch. Die ausgemachte Sache wird nahezu offen kommuniziert; nur mit Mühe vom Richter unterdrückt. Joseph sitzt im Zuschauerraum, betrunken, delirierend und sorgt schließlich für einen Eklat während der Verhandlung. Er muss doch sagen, wer der wirkliche Mörder war. Die Pointe: Am Ende wissen weder Joseph noch der Leser so genau, wie die Sache ausgegangen ist. Joseph befindet sich im letzten Kapitel auf einem Schiff zurück nach Frankreich; er scheint endgültig geisteskrank geworden zu sein, seine Erinnerungen sind verwirrend.
Boyd weist zu Recht darauf hin, dass »Tropenkoller« ein zutiefst antikolonialistischer Roman ist. Simenon versteht es meisterhaft, die Verstörung des wohlstandsverwöhnten Franzosen in ein ihm fremdes und immer fremdbleibendes Land zu erzählen, in der nur wenige Weiße ein auf Dauer verlorenes Regime aufrecht erhalten, in dem sie all das, worauf sie im eigenen Land so stolz sind, hier mit Füßen treten. Der Grad der »Hitze« des Protagonisten korrespondiert dabei mit dem Ekel vor dem Vorgefundenen. Joseph will sich nicht mit einem gefälschten Mordurteil abgeben, selbst wenn es seiner Geliebten zum Vorteil reicht.
Für die Neuauflage hat der Kampa-Verlag auf die frühere Übersetzung von Hansjürgen Wille und Barbara Klau zurückgegriffen. Ergänzt und sicherlich hier und da »entschärft« wurde sie von Ulrike Ostermeyer. Wo früher »Neger« stand, wird jetzt fast ausschließlich »Schwarzer« verwendet. Das nimmt dem Buch nichts von seiner Faszination. Boyds Vergleich mit Joseph Conrads »Herz der Finsternis« stimmt nur bedingt. Conrad lässt den Seemann Charlie Marlow als »Ich« erzählen, Simenon (wie fast immer) bleibt beim allwissenden Erzähler. Conrad erzählt mystisch, insbesondere, was die Landschaft angeht; die Verkommenheit der Kolonialherren wird in einer Person – dem Stationsleiter Kurtz – gebündelt und fast satirisch überhöht dargestellt (wobei auch Marlows Rassismus präsent ist). Simenon agiert subtiler, weniger plakativ, was bei paternalistisch-sensiblen Gemütern Rassismus-Vorwürfe aufkommen lässt. Wie Boyd zurecht anmerkt, kommt kein Weißer in diesem Roman moralisch »davon«. Joseph Timars Wahnsinn ist eine weitere Allegorie.
Den Tropenhelm bei einer Schlägerei, an die sich Joseph nur noch dumpf erinnert, für immer verloren, halluziniert er ein verdrängendes »Afrika, das gibt es nicht!« Ein Ende, das ebenfalls typisch für Simenon ist. Denn die Figur des Joseph lebt im Leser weiter. In einer Mischung aus Mitleid und Ekel.
