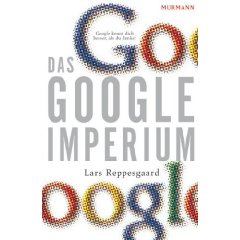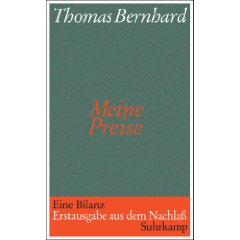Hat man sich nicht schon einmal nach einem Besuch eines der inzwischen so zahlreichen mittelalterlichen Märkte gefragt, wie denn das Leben im Mittelalter tatsächlich gewesen ist? Wie haben die Menschen gelebt? Kay Peter Jankrift verspricht mit seinem Buch, diesen Alltag zu beschreiben. Störend ist dabei zunächst der reisserische Titel »Henker, Huren, Handelsherren« – zumal ein alltägliches Leben streng genommen nicht alleine auf diese drei Berufsgruppen basieren konnte.
Behandelt wird im Wesentlichen das Spätmittelalter von Mitte des 14. bis Beginn des 16. Jahrhunderts; der Fokus der Betrachtung liegt auf der Stadt Augsburg, einer Stadt mit 15.000–20.000 Einwohnern und seit 1276 »Freie Reichsstadt«. Ausführlich erläutert Jankrift warum seine Wahl auf Augsburg fiel und nicht etwa auf Nürnberg oder Köln (mit 40.000 Einwohnern eine für damalige Verhältnisse untypisch grosse Stadt).