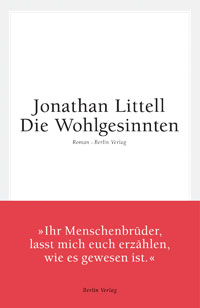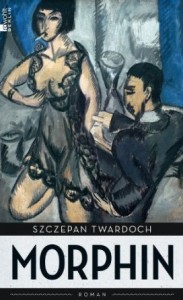
Konstanty Willeman, zerwühltes Haar, blasses Gesicht, Zweitagebart, ist 29 Jahre alt, war Unterleutnant im 9. polnischen Ulanenregiment und lebt in Warschau. Es ist der 53. Tag nüchtern vom Morphin und der 14. Tag der Deutschen in Warschau. Er ist schrecklich verkatert, muss sich übergeben, trinkt aus der Kloschüssel. Oktober 1939. Draußen: Besatzung, Krieg, das vergewaltigte Warschau.
Konstanty ist verheiratet mit Hela, hat einen kleinen Sohn. Die Nächte verbringt er jedoch meist in einer schäbigen Wohnung mit der Prostituierten Salomé, die auch schon mal eine heilige Nutte ist. Wenn diese Freier hat, schmeißt Konstanty sie raus und schreckt dabei auch vor Gewalt nicht zurück. Zum einzigen Lebensziel macht er sich an die Beschaffung des geliebten Morphium. Dann taumelt er durch die zerstörte, entwürdigte Stadt. Von seinem Freund Jacek, einem Arzt, der nur im Krankenhaus »funktioniert« und ansonsten ein depressives, gleichgültiges Nervenbündel ist, könnte Morphium-Nachschub kommen. Jacek wünscht im Gegenzug, dass Konstanty seine vermisste Frau Iga sucht. Dafür gibt es ein Fläschchen, dass er sich mit Salomé teilt. Man erfährt, dass Iga Konstantys erste Geliebte war.
Mindestens drei Ichs
Szczepan Twardoch hat ein wuchtiges Setting für seinen Roman »Morphin« entworfen. Der Überfall Deutschlands und die Aufteilung des souveränen Polen durch Hitler und Stalin sind traumatische Ereignisse in der polnischen Geschichte. Twardoch, 1979 geboren, entwickelt im Laufe des Romans eine bedrückende Topographie einer geschundenen Stadt, die schaudern lässt. In zwei Wochen haben sie uns um zweihundert Jahre zurückgeworfen.