Das Interview von Horst Seehofer in der Wochenzeitung »DIE ZEIT« hat der bayerischen Staatsregierung so gut gefallen, dass sie es gleich ins Internet gestellt hat. Die Google-Suche verzeichnet es vor dem originären »ZEIT«-Text.
Dror Zahavi / Michael Gutmann: Mein Leben (arte/ARD)
Die Frage ob bzw. wie der Film das Buch nun korrekt wiedergebe oder nicht, erweist sich meist als müßig: Zu unterschiedlich sind die Medien, zu grob die Struktur des Films, die in den meisten Fällen die feinen Untertöne des literarischen Werkes nicht im Entferntesten zu entfalten vermag. Es gibt die ein oder andere Ausnahme, die sich zwar eng am literarischen Werk hält, aber dann doch ein eigenständiges Film-Kunstwerk wird ohne die Vorlage zu denunzieren, sondern sie ergänzt, ja, klarer zu macht; leider »too few to mention« (und nicht relevant für diese Betrachtung hier).
Fast selbstverständlich musste die Verfilmung von Marcel Reich-Ranickis Buchs »Mein Leben« (es werden letztlich ausser der mehr als oberflächlich eingestreuten unmittelbaren Nachkriegszeit Reich-Ranickis als polnischer Generalkonsul nur die ersten beiden Teile des Buches bis 1944 gezeigt) hinter dem doch stark beeindruckenden Geschriebenen zurückstehen. In neunzig Minuten presst man die Geschichte von 1929 bis 1944 und hastet von Stichwort zu Stichwort. Man spürt das Bemühen, Schlüsselszenen des Buches unterzubringen (was teilweise auch geschieht), aber Reich-Ranickis anekdotisches Erzählen, was dieses Buch nicht unwesentlich charakterisiert und auf verblüffende Weise stark macht, fällt dieser Ereignis-Rallye als erstes zum Opfer.
Nicholson Baker: Menschenrauch
Übersetzung: Sabine Hedinger und Christiane Bergfeld
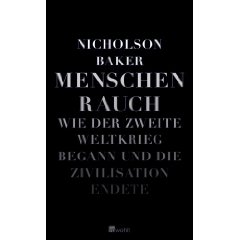
»Menschenrauch« von Nicholson Baker ist ein kühnes, ein waghalsiges, ein fürchterliches, ein aufrüttelndes, ein geschichtsklitterisches – und ein erhellendes Buch. Es ist der Versuch, die Zeit zwischen 1919 und Ende 1941 aus einer anderen Sicht zu sehen. Wo inzwischen die Vokabel des Paradigmenwechsels ein wenig verbraucht erscheint – hier ist sie angebracht.
Tagebuchähnlich collagiert, zitiert und montiert Baker aus Briefen, Artikeln, Aufzeichnungen, Büchern und Verlautbarungen von Politikern, Schriftstellern, Journalisten oder auch nur »einfachen« Bürgern (vorwiegend aus dem angelsächsischen Bereich; aus Deutschland gibt es vor allem Auszüge aus den Tagebüchern von Goebbels, Victor Klemperer und Ulrich von Hassel). Der Erste Weltkrieg wird nur auf ganz wenigen Seiten am Anfang gestreift, die Jahre 1920–1933 auf rund 30 Seiten. Der Zweite Weltkrieg beginnt auf Seite 152, das Jahr 1940 auf Seite 182 und 1941 auf Seite 306. Das Buch endet am 31.12.1941 (Seite 518; danach gibt es ein sehr kurzes Nachwort und umfangreiche Quellennachweise), also als die meisten Menschen, die im Zweiten Weltkrieg starben…noch am Leben [waren] wie Baker schreibt.
Der Gedanke, es handele sich um etwas analog zu Kempowskis »Echolot«-Projekt erweist sich sehr bald als falsch. Bakers Zitate sind fast immer bearbeitet – und er wertet, wenn auch manchmal nur unterschwellig. Nur selten wird das »reine« Dokument zitiert. Manchmal werden auch nur die jeweiligen Zitate gegen- oder aufeinander bezogen. Dieser Stil ist suggestiv bis ins kleinste Detail. So erfolgt beispielsweise keine Datumszeile, sondern es wird narrativ mit einem bedeutungsvollen »Es war der …« im Text agiert. Peinlich genau achtet Baker darauf, dass alles belegt ist; er benutzte ausschließlich öffentliche Quellen bzw. Archive.
Salman Rushdie: Die bezaubernde Florentinerin
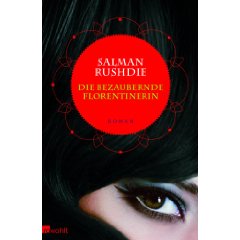
In einem Ochsenkarren kommt er daher, der gelbhaarige Fremde, ein anmutiger Narr…vielleicht aber auch gar kein Narr. Nicht sitzend sondern stehend, aufrecht wie ein Gott, im rumpelnden Gefährt geschickt die Balance haltend. Man schreibt das Jahr 1572 (laut Klappentext) und befindet sich in Fatehpur Sikri, einem Ort jenseits von Religion, Region, Rang und Stamm, der Stadt der schönen Lüge, der Hauptstadt des Reiches von Jalaluddin Muhammad Akbar, dem indischen Grossmogul, dem Weltverschlinger.
Der Fremde sei im Namen der englischen Königin unterwegs und müsse Akbar unbedingt persönlich eine Botschaft der Monarchin übermitteln. Dafür hat er die weite Reise von Europa über das Kap der Guten Hoffnung nach Indien gemacht. Zunächst geht er allerdings in ein Hurenhaus, macht Bekanntschaft mit den Huren Skelett und Matratze. Dort erprobt er erst einmal eine Salbe, die sexuelles Verlangen steigern soll, bevor die beiden Huren ihn mit speziellen Düften parfümieren. Er soll riechen wie ein König damit er die verschiedenen Instanzen am Hof entsprechend überwinden kann und auch tatsächlich zu Akbar, dem Schirmherr der Welt, vorgelassen wird.
Bemerkungen zu Peter Handkes »Die Kuckucke von Velika Hoca«
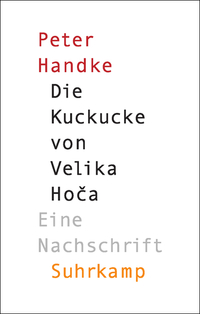
Die Kuckucke von Velika Hoča
Naturgemäss findet Peter Handkes neuestes Buch »Die Kuckucke von Velika Hoča« weder annährend die Aufmerksamkeit noch die fast einhellige Zustimmung wie sein letztes Prosabuch »Die morawische Nacht«.
Es scheint fast ein Gesetz zu sein: Immer wenn Handke Bücher mit der Problematik des Zerfalls seines Arkadien (= Jugoslawien) als Zeugenbericht in der Ich-Form schreibt und Dichter und Erzähler verschmelzen (oder beinahe verschmelzen), scheint ein »Skandal« (also das, was man dafür hält) in der Luft zu liegen.
Der ARD-Korrespondent Andreas Meyer-Feist lässt sich zum Buch im SWR2 befragen. Bemerkenswert, denn so ganz genau scheint er es nicht gelesen zu haben, etwa wenn er behauptet, es handele auch von den Kuckucken, die im Dorf »früher dort zu hören« gewesen wären und jetzt – durch die Klimaerwärmung – nicht mehr. In Wirklichkeit ist Handkes Beobachtung genau anders: Gerade dort, in Velika Hoča, sind diese Vögel noch zu hören (die Symbolik dahinter streift Meyer-Feist nur am Rande).
Der Sprung ins Dunkle

Als Benjamin Disraeli (getrieben von William Gladstone) im Jahr 1867 im sogenannten »Reform Act« im britischen Unterhaus eine Reform durchsetzte die eine soziale Öffnung des Wahlrechts bis weit in die Arbeiterklasse hinein vorsah (vom freien und allgemeinen Wahlrecht heutiger Zeit allerdings noch weit entfernt), war die Empörung im viktorianischen England insbesondere beim klassenbewussten Adel aber auch in der Publizistik gross. Ein »Sprung ins Dunkle« war noch fast die freundlichste Beschreibung dieses als ungeheuerlich eingestuften Vorgangs. »Arbeiter« wurde übersetzt mit »Masse« – und »Masse« und »Pöbel« galten synonym. Konnte man ernsthaft die Geschicke eines Landes in die Hände der Masse geben?
Das Unbehagen an der Masse hat die westliche Geistesgeschichte bis heute nicht ganz verlassen; es handelt sich um einen uralten Topos. Der Bogen kann von Platon über den Vormärz bis Heidegger und Elias Canetti gespannt werden – unterschiedlicher könnten die allesamt der Massenkultur gegenüber skeptischen bis ablehnenden Denker kaum sein (sieht man von den Denkern ab, die die Masse in ihrem Sinne formen bzw. manipulieren wollten).
»Es haidert in Bayern«
Seit einigen Wochen kann man ein interessantes Experiment beobachten: Michael Spreng bloggt. Spreng ist ein Mann, der nicht nur phasenweise mittendrin im »politischen Geschäft« war (als Wahlkampfmanager von Edmund Stoiber beispielsweise), sondern der auf Fingerschnipsen vermutlich sofort diverse Angebote als Leitartikler gängiger Zeitungen oder Zeitschriften bekommen hätte. Stattdessen gibt es nun auf »Sprengsatz« einmal in der Woche einen Kommentar und eine Anekdote, in der Spreng aus dem Nähkästchen plaudert.
Albrecht von Lucke: Die gefährdete Republik
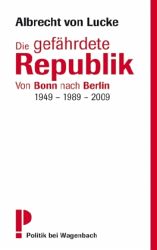
Die gefährdete Republik
»Die gefährdete Republik – Von Bonn nach Berlin« – ein erstaunlicher Titel und wenn man noch dazu die Jahresreihe »1949 – 1989 – 2009« liest ahnt man, welche Melodie hier angestimmt wird. Das Buch kommt zunächst als Bestandsaufnahme sowohl der sogenannten »Bonner Republik«, die mit dem Mauerfall 1989 sukzessive »abdankte« (aber erst fast ein Jahrzehnt später, 1999 mit der ersten Plenarsitzung des Bundestages im neuen Reichstags zu Berlin endgültig zu Ende ging) als auch einer Art Zwischenbilanz der scheinbar noch immer sinn- bzw. rollensuchenden »Berliner Republik« daher.
Die These des Autors: Die Demokratie der alten Bundesrepublik war stabiler (weil besser) in der Bevölkerung verankert als im neuen, souveränen Deutschland. Dabei wird die fast behagliche Situation der »Bonner Republik« aus einer selbstverordneten (und von anderen erwarteten!) Zurückhaltung heraus zu agieren (bzw. zu reagieren) und sich in die Bipolarität des Kalten Krieges, die EWG (später dann EG bzw. EU) und NATO willig einbinden zu lassen als unausweichlich betrachtet. »Nie wieder Krieg« lautete das Grundbekenntnis (und, die intellektuelle Variante, »Nie wieder Auschwitz«, die allerdings – von Lucke erwähnt das durchaus – 1999 plötzlich zu einer Art Staatsraison pervertiert wurde und als Kriegsrechtfertigung diente). Da die Außenpolitik letztlich fast als Indienstnahme von Auschwitz stattfand, konnte man sich auf das Innere konzentrieren; zutreffend ist vom Primat der Innenpolitik die Rede.
