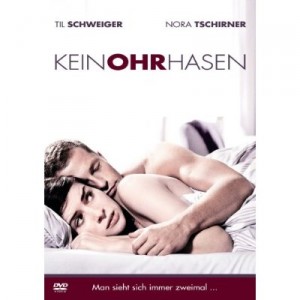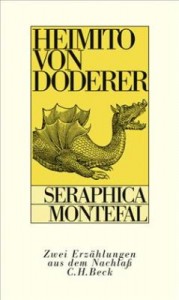Ein amerikanischer Autor erzählt in einem Buch von seinen (illegalen) Reisen auf Eisenbahn-Güterwagen mit einem (imaginären) Ziel »Überall« und nennt dieses Buch »Riding Towards Everywhere«. Wie übersetzt man das kongenial? Vielleicht mit »Reisen nach Überall«? Oder »Fahren in Richtung Überall«? Oder übersetzt man »Riding« wörtlich als »Ritt«?
Der Verlag entschied sich für eine merkwürdig boulevardeske Version, die den Charakter des Buches eher verbirgt, nannte William T. Vollmanns Buch im Deutschen »Hobo Blues« und versah es mit dem ein bißchen aufgesetzt wirkenden Untertitel »Ein amerikanisches Nachtbild«. Das ist zunächst einmal ärgerlich, insbesondere wenn man die Leistung des Übersetzers Thomas Melle im weiteren Verlauf zu schätzen beginnt (beispielsweise dann, wenn er Zitate von Hemingway, Kerouac oder Thomas Wolfe stimmig »modifiziert« wie es in den Fußnoten selbstbewußt heißt).
Man sollte bei der Lektüre den deutschen Titel einfach vergessen und sich vollends den Assoziationen und reportagehaften Beschreibungen zuwenden. Das lohnt sich nämlich.

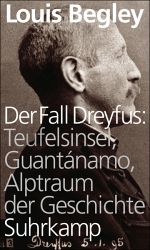
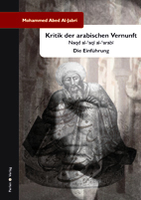 Die »Kritik der arabischen Vernunft« ist ein vierbändiges Werk: Der erste Teil erschien 1984 unter dem Titel »Die Genese des arabischen Denkens«, 1986 erschien »Die Struktur des arabischen Denkens«, 1990 »Die arabische Vernunft im Politischen« und 2001 dann »Die praktische arabische Vernunft«.
Die »Kritik der arabischen Vernunft« ist ein vierbändiges Werk: Der erste Teil erschien 1984 unter dem Titel »Die Genese des arabischen Denkens«, 1986 erschien »Die Struktur des arabischen Denkens«, 1990 »Die arabische Vernunft im Politischen« und 2001 dann »Die praktische arabische Vernunft«.