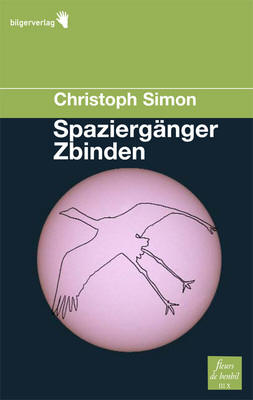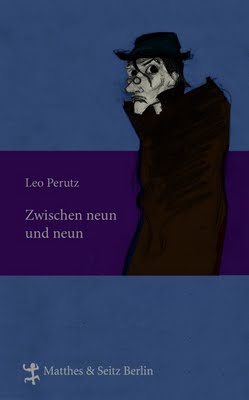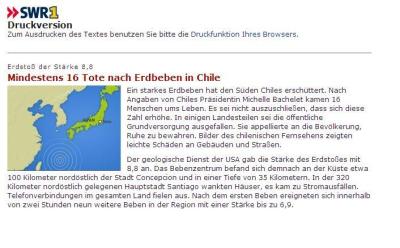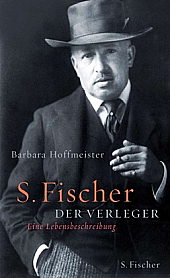Lukas Zbinden ist 87 Jahre alt und geht mit dem neuen Zivildienstleistenden Kâzim einen Tag durch das Betagtenheim. Er stellt ihm die ehrbaren Damen und exzentrischen Herren, die gesprächigen Witwen und die schweigsamen Junggesellen, die routinierten Gehrockbenützer, schlurfenden Stubenhocker mit dörrfleischigen Gesichtern vor, weist dezent auf die Verwirrten, deren Gedanken durcheinanderrollen wie Erbsen auf einem Teller hin und begegnet medizinisch Betreuten mit einem Cocktail in den Adern, bei dem Blut eine nebensächliche Zutat ist. Dieser Ort beherbergt ausgediente Ingenieure, Gewerbetreibende, Büroangestellte, Hausfrauen, Beamte, Armeeangehörige, Feuerlöschgerätekontrolleure, Busfahrer, Übersollarbeiter, Service, Papeterie und Leute, die sich Urlaub erst gönnten, als Ferien gesetzlich vorgeschrieben wurden.
Schon dieser Beginn zeigt die Stimmung dieses Romans an, der ein einziger Monolog des ehemaligen Lehrers Lukas Zbinden ist. Die Entgegnungen der anderen Personen bleiben dem Leser verborgen; er entnimmt sie allenfalls Zbindens Reaktionen. Dieser klettert die Treppenstufen hinab und hinauf als sei er auf einer Expedition (wie eloquent die Benutzung des Fahrstuhls trotz der Mühsal des Treppensteigens abgelehnt wird, obwohl: während der Liftfahrt baut man draußen in wenigen Sekunden die Welt um), nimmt am Alltag der ihm begegnenden Bewohner und Pfleger regen Anteil, lästert vereinzelt ein wenig, amüsiert und ärgert sich über die übertriebene Geschäftigkeit des Heimleiters und stellt Kâzim dabei wie einen persönlichen Pfleger vor.
Weiterlesen