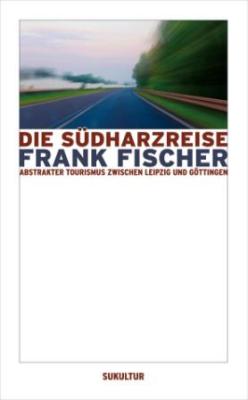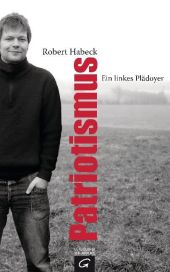[...] Weiterlesen
Frank Fischer: Die Südharzreise
Wieso werden in den Zeitungen neben Büchern und Filmen eigentlich nicht systematisch Autobahnen rezensiert? fragt Frank Fischer am 3. Oktober 2008 um 4.28 Uhr bei Bad Lauchstädt. Da ist er schon seit fast viereinhalb Stunden auf der A38 (bzw. das, was zu diesem Zeitpunkt bereits A38 war) unterwegs. Am 2. Oktober um 23.59 Uhr von Leipzig aus gestartet bis nach Göttingen (21.20 Uhr, 612 km) und am 4.10. um 1:01 Uhr wieder in Leipzig eintreffend (noch einmal rd. 250 km). Daraus entstand »Die Südharzreise« – tatsächlich partiell so etwas wie eine Rezension der A38, etwa wenn um 3.59 Uhr das Kreuz Rippachtal wie eine verborgene Variante der Schwebebahnlinien von Gotham City wirkt (nur ein Beispiel für die im Buch immer wieder aufscheinenden, prägnanten Bilder), dieser »Händel-Autobahn« (wie sie schon halboffiziell genannt wird; der Autor findet treffendere und manchmal fast zärtliche Bezeichnungen).
Ein wenig erinnert das an Asterix’ und Obelix’ »Tour de France«, als die beiden Unbesiegbaren von jedem besuchten Ort eine (meist kulinarische) Spezialität mitbrachten (wobei es Uderzo und Goscinny offengelassen haben, wie man diese Köstlichkeiten vor dem Vielesser Obelix ins Ziel retten konnte). Weiterlesen
Clemens Meyer: Gewalten
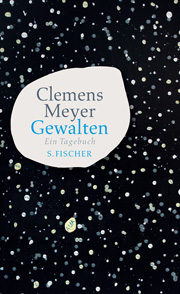
Eine wilde, alptraumhafte Erzählung von einem Mann, der an ein Bett gefesselt, fixiert ist und gerade deshalb schier ungeahnte Kräfte bekommt, beginnt mit dem Bett zu reiten, es bewegt sich sogar und er schreit. »Gewalten«. Dabei Gedankenflut, Galopprennen, Bars, besonders das »Brick’s«, die ewigen 89er, die zur Nikolaikirche pilgern. Leipzig also. Hilflosigkeit, Verzweiflung gepaart mit Trotz und Auflehnung. Eine Schwester kommt, er spuckt ihr ins Gesicht (eine Kunst aus dieser Entfernung und diesem Winkel) und sie kommen mit einem Kissen, welches sie ganz langsam auf sein Gesicht legen und etwas Warmes schießt in seinen Arm, Erinnerung an New York, den Maler Paule Hammer (sein Bild »AUA« ist das Cover des Buches) und später dann ein Ich bin noch da, ihr Schweine.
Eine neue Geschichte, einige Monate später. Der Leser erfährt über die Zwischenzeit nichts. Der Erzähler will sich mit einem Mann am Leipziger Bahnhof treffen, einem Interessenten für Filmdrehbücher. Die ganze Szenerie im Bahnhof ist nahezu kafkaesk, der Agent sucht das schlechteste Café aus, spricht leise, man fachsimpelt über Filme, Regisseure, Peckinpah, Bogdanovich, Szenen, beide sind Kenner, der Fremde verlässt das Café für zehn Minuten und kommt plötzlich mit einer Mappe wieder. Dann ein Schnitt. Plötzlich in seinem verdunkelten Zimmer, sozusagen vergraben, Bilder an der Wand, die grinsen, Abu Ghraib, Guantánamo und die Geschichte von K. Ein moderner K. und der Erzähler erleidet mit, die Demütigungen. Reminiszenz an Charlie Chaplin in »Modern Times« in den riesigen Zahnrädern und dann die Realitäten der Wohnung, die Zigaretten, die er wegspült und dann kurz danach sucht, ob er nicht eine daneben geworfen hat. Der Fall K. als »M.A.S.H.«-Film? Gedanken zum Islam, zum Glauben (ich kann das nämlich nicht mehr), Goethe und sein Respekt vor dem Koran (große Dichtung!). »My film is Guantánamo« wird Coppola paraphrasiert. Und dann verschmelzen alle Figuren, die privaten, die Leute auf den Fotografien, die Frau, die einen Häftling aus Abu Ghraib an der Leine führt und plötzlich ist er K., sieht sich Verhörleuten gegenüber; deliriert. Die Entspannung dann: das Gefühl, in seinem Zimmer beobachtet zu werden, wie in einem »Bernstein« eingeschlossen.
Weiterlesen
Die Unfähigkeit, zu googlen (2)
Stefan Winterbauer schaut ja ein bisschen traurig auf dem Foto. Er hat auch einen Artikel geschrieben, der traurig ist. Traurig für Journalisten.
Winterbauer schreibt für Meedia, dessen Chef Georg Altrogge bei Stefan Niggemeier für die Berichterstattung über einen vermeintlichen Betrug eines Journalisten stark kritisiert wurde. Altrogge hat nun etwas gemacht, was selten ist, er hat sich in die Diskussion bei Niggemeier eingebracht. So weit, so gut.
Irgendwann verlief die Diskussion jedoch nicht mehr so, wie sich jemand wie Altrogge das offensichtlich vorstellt. Er stellte dann irgendwann die »Grundsatzfrage«, die sehr gerne hervorgeholt wird, wenn die Argumente brüchig werden: nach der Anonymität der Kommentatoren. Er schrieb dem Kommentator »treets« am 31.03.10 um 23.07 Uhr:
»Von Ihnen würde ich mir wünschen, dass Sie bei Stefan Niggemeier wie bei Meedia unter Ihrem Klarnamen kommentieren würden. Wenn einer sich so wie Sie annonym [sic!] derart aus dem Fenster lehnt, ist das leider nur feige.«
Ein Hauch von Yamoussoukro
Niemand spricht das hehre Wort von »der Kultur« so inbrünstig aus wie Tina Mendelsohn, wenn sie wieder einmal in einem »Kulturzeit extra« oder irgendeiner Radiodiskussion mit Funktionären und Kulturschaffenden zusammensitzt und über die Zukunft »der Kultur« diskutiert. Leider kommt man dann ziemlich schnell auf den eigentlichen Punkt: das Geld. Hier subventionierte Geldeintreiber, die längst verinnerlicht haben, dass Kultur und Geld siamesische Zwillinge sind und in Institutionen und Etats denken. Und dort die Kommunal‑, Landes- und Bundespolitiker, die mit dem Wort »Kultur« zunächst einmal jene Form von Event-Fetischismus verbinden, den sie jahraus jahrein eröffnen, befeiern, besuchen und beschließen. Wie steht es mit einer »Kultur«, wie sie sich in der Auftaktveranstaltung zur Kulturhauptstadt Ruhrgebiet 2010 in Essen vom 10. Januar 2010 zeigt? Weiterlesen
Leerstelle Gysi?
Marianne Birthler, die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, hatte im ZDF am 22. Mai 2008 (laut Spiegel Online) in Bezug auf ein Treffen zwischen Gregor Gysi und seinem Mandanten Robert Havemann gesagt: In diesem Fall ist willentlich und wissentlich an die Stasi berichtet worden, und zwar von Gregor Gysi über Robert Havemann.
Gregor Gysi hatte gegen die Weiterverbreitung dieser Äußerung geklagt und vor dem LG Hamburg recht bekommen. Das ZDF ging in Berufung und unterlag jetzt erneut. Interessant ist die Begründung. Es geht scheinbar gar nicht darum, ob Birthlers Aussage richtig ist oder falsch. Laut OLG darf die Äußerung Birthlers nur nicht in der Art und Weise, wie dies erfolgte, wiedergegeben werden. Das ZDF schreibt zur Urteilsbegründung auf seiner Webseite: »Nach Auffassung des Gerichts hätte das ZDF jedoch Gysi konkreter zu den Äußerungen Birthlers befragen und Gysis Verteidigungsargumente ausführlicher darstellen müssen.« Weiterlesen
Robert Habeck: Patriotismus – Ein linkes Plädoyer
Die Feindschaft zum Staat als Repressionsinstanz, »Atomstaat«, »Bullenstaat«, als paternalistischer Akteur, Hüter fauler Kompromisse, verstellte den grünen Blick darauf, was (mit einem) geschehen würde, wenn man selbst zu dem gehörte. Der zivile Mut wollte immer über den Staat hinaus, zielte auf die Idee eines Gemeinwesens ohne Staat. Als dann rot-grün 1998 an die Regierung kam, waren die liberalen Vorstellungen von Gemeinwohl nicht mehr gegen, sondern mit dem Staat durchzusetzen. Auf diesen Schritt waren die progressiven Kräfte schlecht vorbereitet und sind es bis heute.
Hart geht Robert Habeck, 41, Fraktionsvorsitzender der Grünen im schleswig-holsteinischen Landtag, mit der Linken im Allgemeinen und seiner Partei im Besonderen ins Gericht (womit die politische Richtung und nicht dezidiert die Partei »Die Linke« gemeint ist). Nach rot-grün, so Habecks These, habe das Land in einer Großen Koalition, die ihre Chancen leider (!) sträflich verpasst habe, vier Jahre verloren. Weiterlesen
Alban Nikolai Herbst: Selzers Singen
»Phantastische Geschichten« werden Alban Nikolai Herbsts Erzählungen, die unter dem Titel »Selzers Singen« soeben erschienen sind, untertitelt (und ergänzt wird das ein bisschen kokett mit: »und solche von fremder Moral«). Das Adjektiv phantastisch ist eine zutreffende Charakterisierung dieser zwölf Geschichten (die kürzeste hat knapp vier Seiten, die längste 24), wobei der Grad der »Phantastik« durchaus unterschiedlich ist. Mal sind es die sich plötzlich zeigenden Flügel bei einer Frau in einer eher tristen Bar am Heiligen Abend (»Kristalle«) inklusive Verhaltensregeln (»Sie müssen sich an meinen Flügeln festhalten«) und einem filmrissähnlichen Erwachen am nächsten Tag (welches nur eine Ahnung des Geschehenen aufgrund eines fremden Gegenstandes in der Wohnung zulässt). Und in einer anderen Geschichte droht apokalyptisch raunend »Die Unheil«.
Oder, gleich zu Beginn, eine grotesk-übertreibende Satire auf den Literatur- und Kunstbetrieb, der seine unliebsamen Protagonisten in einer Art Spukschloss kaserniert (»Die Wiepersdorfer Ankunft«). Plastiklektoren hängen dort herum und bei Fehlverhalten gegenüber dem Kleingedruckten, welches man bei Einlass unterschrieben hat, drohen unter anderem Steinigungen oder Schächtungen zum allgemeinen Vergnügen von Kritikern und Kulturbürokraten eines Deutschen Literaturfonds. Unter scheinbar falschen Voraussetzungen ist dort nun der Schriftsteller Herbst eingetroffen, der nicht schlecht über diesen Ort zwischen Dürrenmatt-Klinik und Haus Usher staunt, in dem die Naturgesetze scheinbar außer Kraft gesetzt sind und der auch nebenbei so ziemlich alle Vorurteile über Künstler bestätigt. Am Ende sitzt man im Speisesaal und eine Melange aus zermatschten Spaghetti und Kippendreck ist über die Tische verschmiert. Wer möchte, entdeckt hier viele Persiflierungen auf die Kulturszene und einige ihrer Akteure (und man ahnt, warum Herbst auf seinem Weblog »Die Dschungel« das Kapitel über Literaturkritik mit »Die Korrumpel« überschrieben hat).
Zwei Erzählungen von Tönen
Filigraner und weitaus kunstvoller geht es in »Clara Grosz« zu, als eine von ihrem Partner ankündigungslos verlassene, hochschwangere Cellistin Kerstin, die dennoch ihren Verpflichtungen mit dem Orchester nachkommt und weiterhin die ganze Welt bereist, plötzlich den Sehnsuchtston trifft, eine ganz leichte, weniger hör- als fühlbare chromatische Verschiebung, aus der etwas Jenseitiges herüberschwang. Der Wunsch, dieses Wunder immer neu reproduzieren zu wollen, führt sogar dazu, dass sie auf der Bühne gebärt und erst im letzten Moment mit dem Musizieren abbricht. Unter Johannes, der ihre Rolle an diesem Abend weiterspielte, b l i e b an diesem Abend der Klang; das Kind wurde Clara genannt. Herbst gelingt es in dieser bisweilen leverkühnartigen Musikerzählung großartig, eine entsprechende Stimmung zu erzeugen und am Ende wird das Wunder des Findens »des Tons« (eines naturgemäss theoretischen Ziels) mit der Geburt eines Kindes mit schöner Leichtigkeit verknüpft und ein Zusammenhang der beiden Ereignisse herbeibeschworen.
Ins bedrohlich-dämonische changiert dann »Ein Ton«, in der ein Ich-Erzähler monologisch die Geschichte seines Ton-Hörens erzählt. Wer glaube, hier werde eine Entwicklungsgeschichte einer sich anbahnenden Tinnitus-Erkrankung geschildert, irrt. Die Angelegenheit ist komplexer, weil der im Erzähler wesende, sich immer stärker ausbreitende Ton seinerseits zum Wesen wird. Er wird durch die Erzählung des Protagonisten anthropomorphisiert. Dessen anfänglicher Gehörschmerz steigert sich zum Schlupfwespenton. Das Wunder, welches sich bei Kerstin als vollkommener Ton ereignete, wird hier zum Fluch (es liegt nahe zu vermuten, dass er Erzähler ebenfalls musisch gebildet ist): Die Welt setzt sich still, in dem ihr der Ton die Laute abzapft: Der Ton materialisiert sich, wird Subjekt, bekommt Zehen, Schenkel und Kopf. Der arme Mensch wird schier wahnsinnig, unternimmt Selbsttötungsversuche und fleht darum, eingemauert zu werden. Eine Suada aus Hoffnungslosigkeit und kurzen, scharfsichtigen, biografisch-reflexiven Momenten setzt ein. Sätze wie Erschwerend tritt hinzu, dass ich meinen Vater nicht kenne werden eingestreut; sie belegen diese seltsam regressive Form einer Verdüsterung, die als Ausflucht nur das Erinnernde kennt, weil es keine Zukunft mehr gibt.
Abermals wäre eine naheliegende Deutung, der Autor wolle hier gegen den allgemein uns umgebenden Akustikschrott beispielsweise in öffentlichen Räumen protestieren, zu profan. Herbst treibt es im zweiten Teil dieser außergewöhnlich suggestiven und mitreißenden Erzählung noch weiter: In einer Art Klinikprotokoll wird nicht nur der Krankheits- und Leidensweg des Patienten (beispielsweise anhand seiner rapiden Gewichtsabnahme) dokumentiert, sondern es wird gezeigt, dass des Erzählers Einschätzung einer Materialisierung des Tons keineswegs ein Wahnsinnsgebilde war, sondern der Realität entsprach und die Station sozusagen usurpiert wird von diesem Ton. Gegen Ende dieses von einem nicht näher Bezeichneten verfassten Protokolls heißt es: Der Ton überall und gleich darauf ist es wieder [v]öllig unklar, ob ich ihn nur halluziniere, wobei dies wiederum vorher durch die Erzählung des Verhaltens des anderen Personals der Station schön längst aufgehoben wird, wenn es etwa heißt Die tobende Schwester B. fixiert.
Gegen die Qualität dieser expressiven Erzählungen kann »Lena Ponce« nicht bestehen. Hier begegnet ein Mann während eines Aufenthalts in Buenos Aires einer Frau und verfällt ihr aufgrund ihres muskulöse[n] Rücken[s] praktisch sofort. Es gelingt ihm, mit ihr in Kontakt zu kommen, wobei ihr distanziertes Verhalten auf ihn eher stimulierend als abstoßend wirkt. So schaut sie ihn niemals an, sondern stets an ihm vorbei oder blickt zum Boden. Statt eines erwünschten Liebesabenteuers offenbart die Frau namens Lena, dass sie als Bedingung erwartet, dass ihr Mann umgebracht wird. Die gängigen Motive (Hass, Eifersucht, Geldgier) negiert sie (was vermutlich bewusst gesetzt ist, um die Mystifikation von Person und Geschichte voranzutreiben und das Genre des Kriminalstücks zu vermeiden). Die Tat geschieht (im zweiten Teil der Erzählung wird personal erzählt) und Lena gibt sich ihm in seinem sehr hässlichen Pensionszimmer hin. Aus dem Bett heraus werden sie von der Polizei verhaftet und beide eher geleitet als abgeführt und Lena wurde in das eine Auto, er in ein anderes gebeten..
»Enorme Kühle«
In »Geliebte Männer« begibt sich ein Ich-Erzähler zu einem Autor (der Deters heißt, wie Herbsts »Kompagnon«, mit dem er zusammen u. a. eine Webseite betreibt), der für ihn als ein Art Ghostwriter fungiert. Als ein neuer Auftrag in Aussicht steht, trifft er Deters in einem Lokal. Dieser beginnt nun in fast bernhardscher Manier über den männlichen Geliebten, seine weibliche Rolle und die Unbillen der Frauen-Emanzipation zu dozieren. Hier ist eher der zweite Teil des Untertitels bestimmend und ein bisschen arg holzhammerartig soll hier eine politische bzw. gesellschaftliche Inkorrektheit literarisiert werden. Wen dies noch aufregt, ist selber schuld, und Alban Nikolai Herbst parfümiert sich hier ein bisschen zu sehr als raubeinig-lüsterner Agent Provocateur.
In der Titelgeschichte »Selzers Singen« begegnet eine weibliche Erzählerin dem soignierten, schüchternen, älteren Herrn Selzer. Abermals spielt die unterschwellig erotische Anziehung eine große Rolle (die im deutlichen Gegensatz zur derben Wollust steht), etwa wenn sie bekennt Er zog mich an wie Nacht. Diese Verlockung wird durch Selzers enorme Kühle und seinem seelenlose[n] und berechnende[n] Blick noch verstärkt. Er sprach im Leidenston eines Menschen, der nicht sterben darf. Leider ist hier das Ende allzu vorhersehbar und Selzers Singen ist ein (profan) orgiastisches, das im Stürzen unterging. Das Motiv des Ausbruchs des Menschen aus der Zeit wird in der kurzen Erzählung »Bornholmer Hütte« dahingehend variiert, dass ein Mann als einzige Möglichkeit, seinem greisen Vater zu entgehen (was vermutlich bedeutet: sich von der genetischen und sozialen Prägung zu emanzipieren), während eines Abends immer jünger wird und schließlich in der Pubertät anzukommen scheint (wobei die Deutung, es würde eine Art physischer Demenzausbruch beschrieben, vollkommen abwegig wäre).
Die längste Erzählung (»Charlotte von Lusignan«) ist vordergründig eine Ehe- und Wahnsinnsgeschichte, in der ein Mann von seiner Frau Charlotte erzählt, die scheinbar verschwunden und Monate später als Schlange wiedergekehrt ist. Nur ihren Kindern, die seltsam vorgealtert wirken, erscheint sie danach noch als Mensch. Der Mann berichtet der Polizei, die ihn wohl als Mordverdächtigen aufgesucht hat, aber nur einen verwirrten Mann mit einer Anakonda antrifft. Herbst genügt hier die bloße Mystik einer Verwandlungsgeschichte nicht und fügt noch – durchaus anspielungsreich ornamentiert – das Motiv der weiblichen Menstruation hinzu, denn Charlotte bedingte sich alle vier Wochen samstags einen Tag für sich aus, an dem sie sich in einer Klausur separierte und eine Art Blickverbot aussprach. Fast magisch scheint sich denn auch die Verwandlung der Frau (respektive das vorausgehende Verschwinden) in der Badewanne zu ereignen, als der Mann dieses Verbot orpheushaft bricht. Im Symbol der wiederkehrenden Schlange schwingt nun neben den bereits angesprochenen Motiven auch eine gewisse Portion okkulter Kundalini-Beschwörung mit, die abermals als Quell mannigfaltiger Interpretationen dienen kann.
Ovid, Tommaso Landolfi und eine kleine Screwball-Komödie
Der Band endet wie er begann: selbstreferentiell in Bezug auf den Literaturbetrieb und den Dichter selber, der in fünf der zwölf Erzählungen durchaus sein eigener Protagonist sein könnte (was zweifelsohne beabsichtigt ist, um durch eine gewisse Realitätsnähe das Phantastische als stärkeren Kontrast herauszustellen). In einem »Bericht an eine Lesestiftung« (die Anspielung auf Kafka ist durchaus gewollt) wird der Erzähler Alban Nikolai Herbst in ein Projekt eines Radio- und Fernsehsenders eingebunden, welches das schnellste Buch hervorbringen will. Die Bilder des schreibenden Dichters in seiner Wohnung werden von Aliens, Etwasse von 1 Meter 30, gemacht, die später ein ganzes Inforadio verspeisen. Herbst geht hier durchaus selbstironisch zu Werk und persifliert seinen Machismo. Die screwballhafte Szene im Fernsehstudio und nachher auf dem Bahnhof ist ein bisschen unübersichtlich und überraschend anstrengend zu lesen. Gelegentlich hat man den Eindruck eines leicht aufgesetzten Humors (ein Gedanke, der in der Wiepersdorfer Schlosserzählung nicht aufkam). Dass am Ende Herbst eine Figur aus dem Tross noch erschossen haben soll, lässt einen dann irgendwie kalt.
Die besten Erzählungen dieses Buches eröffnen tatsächlich in ihrem phantastischen Verlauf neue, sinnliche Räume und schwingen im (!) Leser lange nach. Einige könnte man durchaus als Novellen bezeichnen. Herbst bedient sich sowohl bei den großen, fernen mythologischen Erzählungen (der Bibel; der griechischen Götterwelt; Ovid) wie auch bei der literarischen Romantik bis in die Moderne hinein. So entdeckt man unwillkürlich starke motivische Parallelen mit dem renommierten, aber leider viel zu wenig bekannten Tommaso Landolfi und seinen phantastisch-grotesken Erzählungen. Aus jüngster Zeit wird man mitunter an Botho Strauß’ paradoxe Miniaturen »Mikado« oder Xaver Bayers »Die durchsichtigen Hände« erinnert. In individueller Stilistik und eigener Sprache entwickelt Herbst Erzählungen, die ihren eigenständigen Rang haben und keineswegs eklektizistisch sind.
Aber immer dann, wenn er seinem Erzählen nicht so recht traut und ein bisschen tabubrecherisch und/oder originell sein möchte (sei es durch die übertrieben emphatische Mystifizierung der Regelblutung einer Frau [vom Mond geschicktem Blut], eine eher beiläufig hingerotzte Bemerkung zur Verbindung zwischen Mutter und Kindsmord, ein Mobiltelefon und dessen Vibrationsalarm im Schritt oder einfach nur durch das bewusst gezielt-provokative Einstreuen negativ konnotierter Begriffe) beginnen die Erzählungen zu torkeln und mit dieser Form des rechthaberischen Ästhetisierens wird dann zuverlässig die sich gerade aufbauende Aura zerstört. Andererseits enthalten die Erzählungen durchaus eine Fülle feinster Formulierungen, die man sich gerne merkt und so noch nie gelesen hatte. Daher ist »Selzers Singen« eine Lektüre, die nicht nur aufgrund der »starken« Geschichten zu empfehlen ist.
Die kursiv gesetzten Passagen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.