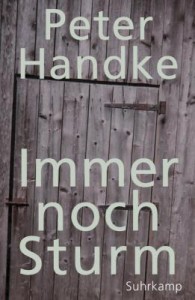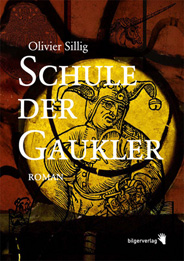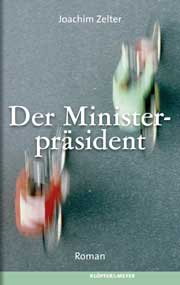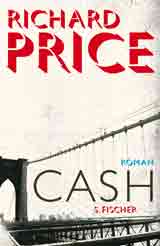Ein Ich-Erzähler sitzt auf einer Bank auf einer Wiese, in der Heide, im Jaunfeld. Ein Apfelbäumchen behängt mit etwa 99 Äpfeln gibt ihm Schutz und er kommt ins Phantasieren, ins Heraufbeschwören. Aufmarsch der Vorfahren. Sie erscheinen ihm – oder er lässt sie erscheinen? Er ist der einzige, der sie noch träumt: Nicht ich lasse euch nicht in Ruhe. Es läßt mich nicht in Ruhe, nicht ruhen. Ihr laßt mich nicht in Ruhe. Im Laufe der Erzählung (oder ist ein Drama?) frischt der Wind auf, kommt von vorne, von hinten und von oben, wird zum Sturm (zum Erinnerungssturm sowieso). Und die Landschaft, die Kindsheimat, nein: die Bleibe, dieses wiedergeholte Kärnten verändert sich im Laufe dieser Ahnen-Epiphanien. Das ist mehr als nur die Suche nach den eigenen Wurzeln. Vielleicht ist »Immer noch Sturm« das wirkliche »Nachtbuch« Peter Handkes (und das vor wenigen Wochen erschienene ist nur ein Präludium).
Zeitreisen
1936 ist die erste Station der Zeitreise, oder um was es sich handelt. Die blutjunge (spätere) Mutter, die Karawankenfranzösin, ansonsten namenlos; sechszehnjährig. Der Affensohn, das Fastkind Benjamin mit seiner wunderbaren Ekellitanei. Der selbstbewusste ältere Bruder Gregor, der Einäugige, von der Landwirtschaftschule kommend, mit seinem Werkbuch vom Obstbau; ein Apfelmensch. Valentin, der Mutterbruder. Die Schwester Ursula, die die anderen spüren läßt, daß sie nicht geliebt wird. Der Vater (des Erzählers Großvater) und dessen furiose Suaden wider das allzu schnelle und beliebige Gebrauchen der großen Worte. Und seine Frau, die Großmutter, die immer allen gut sein will.