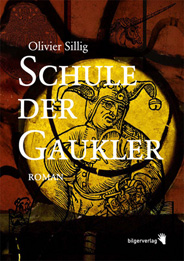
Olivier Sillig: Schule der Gaukler
Mit den letzten Worten der in der Scheune bibbernden Kinder beginnt das Buch. Dann kommt der Rosstäuscher und nimmt den siebenjährigen Tiécelin mit. Dieser denkt, es ist der Tod, der ihn ergriffen hat. Aber dann merkt er: Hardouin, ein schon 60jähriger Schausteller, hat ihn gerettet. Von nun an sind sie unzertrennlich. Tiécelin ist frühreif, klug, frech, vorlaut, charmant – und immer lernwillig und loyal Hardouin gegenüber, der ihn mit Liebe ohne Strenge erzieht und auf seinen »Beruf« einschwört. Schließlich soll er Menschen ansprechen und dazu verleiten, gegen Geld das Ding, wie Tiécelin diese seltsame Gestalt nennt, anzuschauen.
Der Leser taucht mit einem allwissenden Erzähler in den Kosmos des zu Ende gehenden 15./beginnenden 16. Jahrhunderts ein. Unweigerlich drängen sich die Bilder des 250 Jahre später spielenden Romans »Das Parfüm« von Patrick Süsskind auf. Aber Olivier Sillig findet in diesem Märchen für Erwachsene schnell einen ganz eigenen Ton. Er will dabei weder eine spektakuläre Kriminalgeschichte erzählen, noch sitzt er diesem unsäglichen »Fantasy«-Boom auf oder kokettiert mit dümmlich-biederen Vampirgeschichten. Dabei erleben die Protagonisten sehr wohl Mystisches genau so wie das pralle Leben mit Liebesleid und glücklichen Augenblicken. Die Wahrsagerin Grand Macabre (ein herrlicher Name!) rührt schon ihre Mixturen zusammen und erzählt Tiécelin mit großem Pomp die Geschichte, wie das Ding vor hunderten von Jahren gelebt hat, ums Leben kam und in diesen Behälter konserviert ist. Wir erfahren von Hardouins (sexueller) Affäre mit dem Priester Hieronymus. Und sein erster Assistent Juan erliegt immer mal den Verlockungen eines Stricher-Lebens, wenn sie in einer Hafenstadt einkehren und schließlich schifft er sich auf die Nona, eines der Schiffe von Christoph Columbus ein. Wie Tiécelin erfährt der Leser im Laufe der Zeit immer mehr – aber nicht alles. Rückblicke vor 1490 sind selten; Hardouins Kindheit und Jugend bleibt weitgehend verborgen. Nur das er eine Ausbildung von Mönchen erhielt und für damalige Verhältnisse gebildet war, schimmert durch. Und das er in Notwehr einen Seemann tötete, als dieser einen Jungen vergewaltigte. (Ein bisschen sehr zeitgenössisch, wie Sillig das offensichtliche Häretikertum Hardouins einfließen lässt und als vermeintliche Selbstverständlichkeit darstellt.)
Mondgesicht
Irgendwann begegnet Tiécelin einem schwachsinnigen Kind etwa seines Alters, das nicht sprechen kann und sich immer wieder vollmacht. Es wird von anderen Kindern wie ein Gegenstand getreten. Ihm blüht ein Heim, welches Kinder wie ihn wie Schweine hält. Er nimmt das Kind auf, nennt es Mondgesicht und ihm gelingt es, dass es »sauber« bleibt. Flugs integriert sich Mondgesicht mit seinem Spiel auf dem Musikholz in die kleine Gemeinschaft. Tiécelin in seinem Gauklerkostüm wird schnell der neue Liebling der Fahrenden auf dem Markt. Statt Konkurrenzneid gibt es hier Zusammenhalt.
Aber die Idylle wird immer wieder gestört. Bei einem Überfall tötet Tiécelin einen der Räuber, als dieser Mondgesicht töten wollte. Hardouin hilft dem Achtjährigen diese Situation zu verarbeiten, in dem er Tiécelin bei dem improvisierten Bestatten des Räubers zuschauen lässt. Später stößt noch die blinde Ava zur Truppe, die nur vier Jahre älter als Tiécelin. Sie verliebt sich in dem Herumtreiber La Sole und wird von ihm unverhofft schwanger. Als Tiécelin La Soles entstelltes Gesicht mit Hilfe einer Maske verschönert, wird er für Ava uninteressant (sie kann nur die Maske berühren, aber nicht mehr das Gesicht). Die Blinde mag die Prothese der Schönheit nicht. La Sole wird eitel und verlässt sie. Aber auch das ist keine »Katastrophe«: Tiécelin hilft Ava bei der Geburt ihres Sohnes Louve (der Name ist eine Wortschöpfung von Mondgesicht) und fortan gehören sie zusammen. Und so sind sie auf Tour und reisen mit ihren kleinen Attraktionen durch ganz Europa. Ava singt und erzählt, Mondgesicht macht Musik, bald beginnt Louve eine kleine Dressur. Dabei ersetzt Tiécelin bei Bedarf kongenial die bei den anderen fehlenden Sinne und profitiert andererseits von ihren speziellen Fähigkeiten. Ihnen ist wohl – und das trotz aller Unbillen auf ihren langen Reisen. Später kommen noch zwei weitere Personen zum Gauklerzug hinzu: ein Ritter und sein Knappe; Kriegsversehrte, die sich anfangs ihre Behandlung von den Gauklern erpressen wollen und später dann zu allerlei schönen Überraschungen führen (die hier nicht verraten werden sollen). Aber die Truppe bleibt nicht vom Unangenehmen verschont: Mondgesichts frühes und rasches Sterben wird bewegend inszeniert.
Der Henker und die Würde
»Schule der Gaukler« umfasst den Zeitraum von ca. 1490 bis 1504. Sillig erzählt nicht streng chronologisch und nach zwei Dritteln des Buches erfolgt ein Zeitsprung in die Zukunft: Hardouin trifft um 1502 (er ist nach einem Schlaganfall fast gelähmt und kann nur sich noch mit seinen Augen und einem Finger bemerkbar machen) unverhofft auf seinen ehemaligen Assistenten Juan. Dieser ist Henker und Verwalter der Richtstätte vor Marseille; diesem Golgatha vor Marseille, vor vielen Jahren in einer Mischung aus Bewunderung und Angst die beiden so erschütterte. Die eigentlich barbarische Aufgabe des Henkers vollbringt Juan, wie es fast ein wenig provokativ heißt, mit Würde; der hilft den Todgeweihten, dass sie keine Schmerzen erleiden und ihr Todeskampf den Umstehenden, die sich immer wieder zu den Exekutionen einfinden, verborgen bleibt. Juan erzählt von seinen Abenteuern auf hoher See und von seinen Gefühlen, als er Hardouin zehn Jahre vorher so unverhofft verließ, nach dem sie jahrelang zusammen gearbeitet hatten und gutes Geld verdienten. Bei einem Angriff von Eingeborenen auf einer fernen Insel wurde er so stark verletzt, dass er nun ein Holzbein hat. Dann arrangiert Tiécelin dann die Begegnung des schwerkranken Hardouin mit Hieronymus, seinem Lebensmenschen, und für kurze Zeit blüht der Alte wieder auf und gesundet fast vollkommen. Als er nach mehr als einem Jahr von der Truppe wieder aufgespürt wird und in Demenz verfallen ist (Hieronymus bleibt verschwunden), sorgt Tiécelin für seinen würdigen Tod. Er wird ihn am Ende als seinen Vater bezeichnen.
Olivier Sillig erzählt dieses Märchen in fast epischem Stil mit großer, menschenfreundlicher Geste. Obwohl es auch durchaus deftige (zumeist homoerotische) Schilderungen gibt, fühlt man sich zuweilen an Stifters sanftes Gesetz erinnert und vielleicht begreift man hier endlich, was damit genau gemeint sein könnte. Nie versucht der Autor sensationalistisch zu erzählen; von klebrigem (Disney-)Kitsch, den man vielleicht am Anfang befürchtet, ist das Buch meilenwert entfernt.
Erzählung ist besonders für Tiécelin fast Medizin, mit der die Sehnsüchte gebannt oder vielleicht sogar erfüllt werden; Synonym für Teilhabe am Leben. Da wirken die eingestreuten Lebens- und Vergeblichkeitsmetaphern (wie beispielsweise die der Schildkröte, die zum Topos des »absurden« Lebens wird und den verrückt gewordenen Hardouin nicht mehr loslässt) eher störend. So ganz konnte Sillig wohl der Versuchung, einen philosophischen Überbau à la Gaarder mindestens anzudeuten nicht widerstehen, was bedauerlich ist, da an vielen Stellen gezeigt wird, wie stark die Kraft des Erzählens sein kann. Dennoch ist »Schule der Gaukler« ein faszinierendes, zum Teil fesselndes Buch. Man legt es, einmal in ihm versunken, so schnell nicht mehr aus der Hand.
Die kursiv gesetzten Stellen sind Zitate aus dem besprochenen Buch.