Wenn man erst einmal weiß, dass einige (Polit-)Talkshows im (deutschen) Fernsehen nach gewissen dramaturgischen Inszenierungen besetzt werden – beispielsweise um während der Sendung ordentlich Krawall zu erzeugen – kann man diese pervertierte Form des Diskurses nur noch als lächerliches Schmierentheater ertragen. Sein eigenes Urteil wird man hier kaum schärfen können, zu bescheiden sind die intellektuellen Herausforderungen. Es spricht leider einiges dafür, dass das Feuilleton in ähnliches Fahrwasser abdriftet. Und nein: Damit sind nicht die (teilweise zu Recht diskreditierten) Twitterlümmel und Blogdamen und ‑herren gemeint, die ihre gesinnungstriefende Meinungs-Halbbildung in die Welt hinausposaunen und jedes noch so kleine Phänomen skandalisieren. Längst hat das organisierte Denunzieren auch die sich selbst immer noch als Qualitätsmedien bezeichnenden Institutionen ergriffen.
Die archäologische Obsession
Gefunden werden
Die archäologische Obsession erkläre ich mir so: sie ist die Sehnsucht, endlich alles hinter sich zu haben, Jahrtausende zwischen der peinlichen, lächerlichen, nichtsdestotrotz unerträglichen Misere des So-zu-Tuns-als-ob-man-lebte und dem offensichtlich unerwünschten Selbst zu wissen. Man wäre dann unerreichbar für die notorischen Lebensbejaher und die Tu-dir-was-Gutes-Missionare, sogar wenn sie gleich im Grab nebenan lägen. Vor allem wäre der Akku ihrer Handies korrodiert und endlich, endlich Ruhe.
Dann würde ich vielleicht ausgegraben von jemandem, der sich für das interessiert, was an mir am wenigsten wertvoll war und daher übrigblieb. Mit Samthandschuhen würde jener Jemand mein Wertlosestes berühren. Er wird. Er wird ein Leben für mich erfinden, das mein tatsächliches auch dann noch übertreffen würde, wenn es ein überdurchschnittlich schönes gewesen wäre. Mein Name wird zumindest so etwas wie »XX-Prinzessin« enthalten (der »XX«-Teil ist allerdings unberechenbar). Dafür werde ich das Glotzgeäuge an der Museumsvitrine stoisch über mein Gerippe ergehen lassen; im Leben gab es durchaus Blöderes zu ertragen.
Der Archäologe wird mich finden, wie mich kein Zeitgenosse jemals finden könnte. Er wird glücklich sein über das Wenige, das ich noch sein werde, anstatt nur Unzulänglichkeiten zu bemängeln an dem beträchtlichen Haufen diversen Materials und Feinstoffs, der ich lebend bin.
Meine einzige Arbeit besteht darin, herauszufinden, wohin ich mich legen muss, damit er mich finden wird. Ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende können die Topographie ziemlich verändern, es kommt also darauf an, in der richtigen geologischen Schicht zu expirieren. Wenn ich manchmal einen Zweifel schiebe, dann diesen: ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gefunden werden will. Es soll nur vorerst einmal einfach irgendwie aufhören.
9. Januar 2009
Nein, finden
Sich in eine geologische Schicht legen, um von einem Archäologen des 4. Jahrtausends ausgelocht zu werden, so ein Quatsch!
Die Verhintzung
Am Sonntag und Montag konnte man im deutschen Fernsehen zwei Talkshows anschauen, die auf vertrackte Weise die Grenzen dieses Formates offenbarten. Es ging wieder einmal um Bundespräsident Wulff und seine diverse Affären und Affärchen. Die Gemeinsamkeit in den beiden Sendungen: de ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Hintze trat in seiner bereits zu Kohls Zeiten berühmten Mischung aus Emsigkeit und Frechheit als Verteidiger Wulffs auf.
Bei »Günther Jauch« am Sonntag sah man am Ende nicht nur beim Moderator die Erleichterung: Die Sendung ist überstanden. In der FAZ hieß es von Michael Hanfeld am nächsten morgen, Hintze habe geredet, wie der FC Bayern gelegentlich spielt: 70% Ballbesitz, aber trotzdem verloren. Einen Tag später stand Hintze dann wieder Rede und Antwort – in Frank Plasbergs »hart aber fair«. Ihm zur Seite das ehemalige FDP-Mitglied Mehmet Daimagüler, ein Rechtsanwalt aus Berlin, der seine Sympathie für Wulff mit dessen Rede vom 3. Oktober 2010 begründete (»der Islam gehört…zu Deutschland«).
Ansonsten war Peter Hintze fast allein zu Gast. Mit Wuseligkeit und autoritärem Gehabe wischte er alle Anschuldigungen vom Tisch. Alles sei widerlegt und aufgeklärt, so Hintze. Bei Plasberg entfleuchte ihm sogar die Aussage, dass die Vorwürfe durch seine Aussage alleine als widerlegt zu gelten haben. Da konnten die anderen Kombattanten nur enerviert den Kopf schütteln. Und die Zuschauer empörten sich über Hintze.
So sind sie halt...
Ich gestehe dass ich das sonntägliche Ritual, sich um 20.15 Uhr den ARD »Tatort« anzusehen immer mehr bereue: Zu schlecht, zu durchschaubar, zu holzschnittartig und auch zu zeitgeistig kamen in den letzten Monate diverse Krimis dieser Reihe daher. Die Schilderungen der privaten Problemchen und Probleme der ermittelnden Kommissare nebst deftigem Lokalkolorit kommen inzwischen leider viel zu routiniert daher, dass man sie länger als sagen wir einmal 60 Minuten aushalten kann ohne in gähnende Langeweile auszubrechen.
Zugegeben: Das war gestern im österreichischen »Tatort« »Kein Entkommen« anders. Ein Student – Fahrer einer Putzkolonne – wird angeschossen: Die Mörder entdecken, dass sie den falschen erwischt haben und strecken ihn mit einem bedauernden »Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort« mit zwei Kopfschüssen endgültig nieder. Gemeint war ein anderer: Josef Müller, der mit seiner Frau und dem 6jährigen Max zusammenlebt. Müller ist krank; eine Grippewelle grassiert während des Films und zieht nach und nach alle möglichen Protagonisten herunter. Die beiden Killer suchen Müllers Wohnung auf (Frau und Kind sind beim Arzt), der knapp entkommt und mit nacktem Oberkörper durch Wien bis zu den Gepäckschließfächern am Hauptbahnhof irrt. Neu eingekleidet meldet er sich bei der Polizei. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) bestaunen den Mann, der natürlich nicht Josef Müller heisst sondern Gradić und im jugoslawischen Bürgerkrieg auf seiten der Serben Kriegsverbrechen in einer paramilitärischen Organisation begangen hat. Müller gesteht alles und legt das auf den Tisch, was die Mörder haben wollen: Sein Büchlein, in dem er fein säuberlich seine und die Taten seiner Kameraden aufgeführt hat.
Wisława Szymborska
Und so denn glitzert der tote Käfer am Weg, unbeweint der Sonne entgegen. Es genügt, an ihn für die Dauer eines Blicks zu denken: er liegt, als wäre ihm nichts von Bedeutung passiert. Bedeutung betrifft angeblich nur uns. Nur unser Leben, nur unseren Tod, den Tod, der erzwungenen Vorrang genießt. aus: Wisława Szymborska – Von ...
Jürgen Habermas: Zur Verfassung Europas
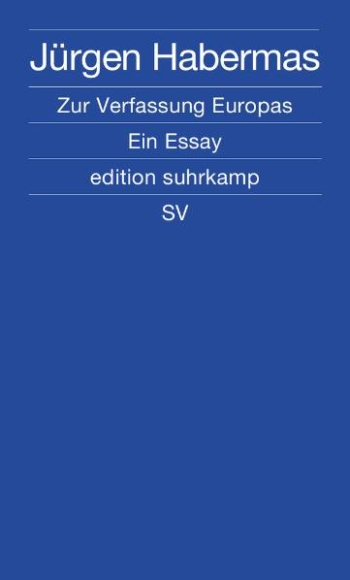
Mit Habermas’ retrospektiven Erläuterungen zum Marktfundamentalismus, der Ende der 1990er Jahre auch die politischen Repräsentanten in Deutschland infizierte (wohl vorbereitet durch entsprechendes mediales Pressing), geht man noch konform. Aber wenn dann aus der rhetorischen Mottenkiste der Begriff der »Politikverdrossenheit« hervorgeholt wird, beginnen die Zweifel. Wobei dieses Phänomen als Produkt einer »politischen Unterforderung« des Bürgers abgeleitet wird, dieser damit sozusagen errettet werden soll und für die weitere Verwendung als politisches Subjekt zur Verfügung steht. Habermas hat natürlich Recht, dass eine ambivalente demokratische Legitimationsbasis des »Eliteprojekts« Europäische Union zum Ver- und/oder Überdruss geführt hat. Und auch seine Feststellung, dass Deutschland seit Rot-Grün 1998 ohne festes (außen-)politisches Ziel regiert wird (er sieht diese Entwicklung von 2005 an noch einmal beschleunigt), ist zutreffend.
Falsches Tortenstückchen
Da staunte der »tagesschau«-Zuschauer gestern nicht schlecht: Die Beteiligung Deutschlands am Euro-»Hilfsfonds« ESM – Gesamtvolumen (erst einmal) 500 Milliarden Euro – beträgt »nur« 22 Milliarden. Kann das sein? Um die Kleinigkeit zu verdeutlichen bediente man sich in der Redaktion der wohl bekannten Tortengraphik:
Euphemismen in der Politik – (IV.) Der Hinterbänkler
Gemeint ist der Hinterbänkler (seltener: die Hinterbänklerin). Es ist ganz leicht, sich über sie zu amüsieren. Journalisten machen das sehr gerne. Erst verschaffen sie ihnen (endlich einmal) einen gewissen Raum – um sich dann darüber lächerlich zu machen. Man kennt das ja mit dem Hoch- und Runterschreiben. Der Hinterbänkler durchlebt diese Phasen in sechs Wochen. Andere Politiker brauchen dafür Jahre.
