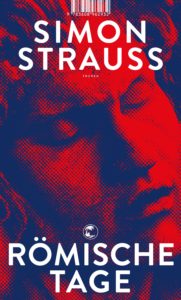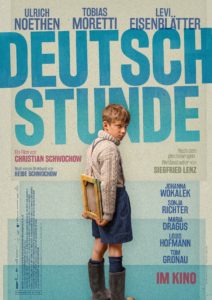
Christian Schwochow verfilmt Siegfried Lenz’ Deutschstunde. Aber warum nur?
Die »Deutschstunde« ist neu verfilmt worden (Kinostart: 3. Oktober). Die »Deutschstunde« von Siegfried Lenz? Genau die. Warum? Und, vor allem, wie? Da war doch der zweiteilige Film von Peter Beauvais von 1971. 600 Seiten auf dreieinhalb Stunden komprimiert; adaptiert. »Von den Freuden der Pflicht« schreibt Siggi Jepsen im Buch als eine Art Strafarbeit, aber auch zur Selbstaufarbeitung in einer Zelle. Einer Gefängniszelle. Weil er vorher, in anderthalb Stunden, nichts hatte schreiben können, weil die Masse der Bilder und Eindrücke zu viele waren.
1968 erschien das Buch »Deutschstunde«. Mitten in den APO-Zeiten. Nun war Siegfried Lenz kein Aktivist; seine politischen Auftritte beschränkten sich in den 1970er Jahren darauf, Willy Brandt im Wahlkampf zu unterstützen. Mit den Revoluzzern der 67er oder 68er konnte er nichts anfangen. Dennoch ging das Buch nicht unter – im Gegenteil. Es wurde ein Bestseller, vielleicht weil es, wie bei meinen Eltern, als »Bücherbund«-Exemplar verschickt wurde, wenn man im Halbjahr nichts anderes ausgewählt hatte (so ist meine Erinnerung). Die Kritik war damals eher verhalten, aber das Buch trotzte eben dem revolutionären Zeitgeist.
Siggi Jepsen, der, als er diesen Mammutaufsatz in ‑zig Schulheften niederschreibt, gerade »erwachsen« geworden ist (also 21 Jahre), erzählt von seinem Vater, dem Polizisten von Rugbüll. Und vom Maler Nansen. Die Männer waren Freunde; Nansen rettete Jepsen einst einmal das Leben. Aber es ist 1943. Und die Bilder Nansens gefallen den Machthabern nicht. Damit gefallen sie auch seinem Freund nicht. Aber der ist nicht nur als Polizist der Überbringer der schlechten Nachricht. Er ist beseelt davon, dass es seine Pflicht ist, das Malverbot der Nazis umzusetzen.