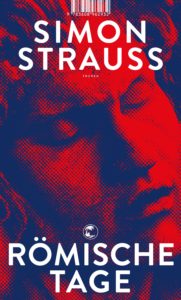
Römische Tage
Ein 1. Juli, ein männlicher Ich-Erzähler, Mitte 30, Ankunft in Rom, »zweihunderteinunddreißig Jahre und acht Monate nach Goethe«. Also ein Schriftsteller, der da schreibt? Ein Stipendiat etwa? Irgendwann ist von einem Notizbuch die Rede. Aber auch von einer Vorstandssitzung, so als kenne sich der Erzähler damit aus. Man erfährt zu Beginn von einer Flucht, um »die Gegenwart abzuschütteln«. »Rom als Heilanstalt«. Heilung von was?
Einzug in die Via del Corso, »ein Zimmer schräg gegenüber von der Casa di Goethe, Goethes Haus«. Wieder diese Referenz. Und er ahnt sie, die Klischees, das Zerrbild von Rom, all dieser berühmten Orte, Straßen, Plätze, das Bekannte, dass schon alle gesehen haben, und dass er, der »Leidenstourist« auch sehen möchte und zwar so, wie es noch nie jemand gesehen hat. Der Wunsch nach der Naivität des ersten Blicks. Es gibt viel Topographie und viel Geschichte in diesem Buch. Und ein Nachdenken, Sinnieren über das, was man Gegenwart nennt und was im Ansichtigwerden dieser modernen Metropole mit deren Jahrtausende alten Bauwerken kontrastiert. Etwa wenn er den Ort von Caesars Ermordung rekonstruiert und parallel dazu das gegenwärtige Stadtbild beschreibt.
Besonders zu Beginn ist der Grundton des Buches wie schon in »Sieben Nächte« von einer trotzigen Wehmut bestimmt. »Sieben Nächte«, jenes Buch, das zu einem Literaturskandal wurde, weil es nicht den erwünschten Mustern einer politisch-identitätsgläubigen Zeitkritik entsprach. Das Vermissen des Dionysischen als unerträglich empfundene Provokation. Man suchte daher fast verzweifelt bis hin zur Sippenhaft nach Indizien für den Duktus der »Neuen Rechten«. Im Verlauf dieses Versuchs einer Ehrabschneidung zeigten sich deutlich die Vorboten einer (Literatur- und auch Kunst-)Kritik, die sich auf das Absuchen verbotener oder mindestens »umstritten« deklarierter Termini konzentriert, die notfalls so lange dekontextualisiert werden, bis die Anklageschrift »passt«.
»Woher kommt dieses dumpfe, wehleidige Gefühl, zu spät geboren zu sein, in Zeiten zu leben ohne Arien und Rausch?«, so fragt der Protagonist. Da war doch jemand, der getan hat, wie ihm geheißen, alle akademischen Hürden gemeistert hatte. Aber am Ende des Marsches durch die Institutionen fand er sich als ästhetischer und sozialer Opportunist verwandelt. Das bolognialisierte Universitätswesen spucke nur mehr Rationalisten aus, die im Laufe ihrer Konditionierung alle Phantasie verloren hätten. (Könnte hierin einer der Gründe für die wachsende Bedeutungslosigkeit von so etwas wie Literatur zu finden sein?) Das Milieu richtet sich unterdessen ein: »Wenn vor wenigen Jahrzehnten noch mit dem Verweis auf die ‘Klassenverhältnisse’ jeder Disput gewonnen werden konnte, reicht mittlerweile die ‘Geschlechterfrage’, um alle auf seine Seite zu bringen. Überall identifizieren wir uns mit den Diskriminierten, fühlen uns aus Solidarität selbst diskriminiert und warten auf Wiedergutmachung durch ein Gesetz.«
In einem faustisch anmutenden Pakt verschaffte sich der Erzähler mit dem Ausleben der sieben Todsünden eine kleine Verzögerung, »um der drohenden Zukunft noch einmal zu entkommen.« Und auch in »Römische Tage« wird nach der Rolle in der Zukunft gesucht. »Oft fühle ich mich wie ein Befallener, zerfressen von vergangenen Idealen, getrieben von unbefriedigtem Ehrgeiz. Wer zu spät auf die Welt gekommen ist, wird seine Zeit nie finden.« Die Ungnade der späten Geburt? Wenige Augenblicke später: »Die meisten sprechen vom Leben als wäre das alles so einfach. Als gäbe es keine anderen Möglichkeiten, als würden wir das Entscheidende schon sehen. So ist es nicht. So war es nie. So wird es immer bleiben.« Gott ist schon lange tot und die Vergangenheit war in höchstem Maße Verklärung und daher basiert die Gegenwart auf den Verklärungen des Vergangenen. Alles schon dagewesen, alles schon gefühlt, alles nur noch Imitation und Kopie. »Es gibt keine Chance, in Rom der Erste zu sein. Dafür darf sich hier jeder wie ein Letzter fühlen«. Am Ende wird nur noch das Erlebte anderer erlebt. Das Goethe-Haus, die Bachmann-Straße, womöglich auch der Winkler-Markt (den Strauß’ Figur nicht evoziert) – alles aus zweiter, dritter Hand; Kanon, der nicht mehr rettet. Wie soll so eine Zukunft entstehen?
So taumelt denn der Erzähler durch Rom, anfangs mit Herzstichen, die ihn ins Krankenhaus bringen und Einblicke in das italienische Gesundheitssystem ermöglichen. Aber dann gewöhnt er sich an die Sommerhitze. Es gibt viele Begegnungen, die fast immer mit Gleichmut erzählt werden. Er trifft einen Theologen (»Mit seiner tief empfundenen Nähe zu Gott gibt er an wie andere mit berühmten Namen in ihrem Adressbuch«), parliert mit einem Kurienkardinal, der ihm einen Rosenkranz schenkt (»so streng nehmen Sie es mit Ihrem Protestantismus doch nicht«), besucht das italienische Parlament (in dem die Abgeordneten über ihre Smartphones Aktienkurse abrufen), diverse Museen und eine Party mit Unmengen Plastikbesteck (welches, so die Aussage, die Frauen emanzipiere, weil sie nicht mehr Geschirr spülen müssten), freundet sich mit Restaurant-Besitzern an, hört Zirkusdirektoren zu, begegnet einem Schauspieler, der »in seiner Not« die Rechten gewählt hat, schwimmt mit einer RAI-Nachrichtensprecherin, der er verzweifelt versucht die Vorteile von »Europa« zu erklären (sie ahnt, dass er selber nicht überzeugt ist) und beginnt eine eher platonische Liebesaffäre mit einer Italienerin, die auch in Rom ihr Glück oder sonstwas sucht. Und es gibt einen eindrucksvollen Bericht einer Tagung, in der ein Philosoph mit einem Satz seinen Ruf verspielt und ein Literaturkritiker von einem angetrunkenen Autor geohrfeigt wird.
Nur gelegentlich wird er von der Gegenwart eingefangen, einem Blick beispielsweise, und dann entsteht eine kurze Phase von Empathie, etwa bei jenem Mann, der an einer Tankstelle den Autofahrern gegen ein kleines Trinkgeld zur Hand gehen möchte. Da wird der Abschied fast zur Elegie: »Ich werde ihn nie wiedersehen, diesen stolzen Tankstellen-Mann, aber dieses eine Mal habe ich ihn gesehen. Sein Bild bleibt mir in Erinnerung.« Ein Bild, das es vorher noch nie gab und daher so kostbar ist.
Manchmal verstrickt sich der Ich-Erzähler in Ungenauigkeiten. So beobachtet er zwei Schachspieler auf einem Platz. Einer »zieht seine Königin vor und die Bauern zurück, raucht und trinkt Bier dabei.« Jeder Schachspieler weiß, dass Bauern nicht zurückziehen können. Und dann dieses spekulative Fabulieren, wenn er aufgrund eines Gesichtsausdrucks oder einer Geste das gesamte bisherige Leben eines ihm eigentlich unbekannten Menschen entwickelt. Dies wird so auffällig inszeniert, dass es der genaue Leser (ein Pleonasmus!) in einer Mischung aus Neugier und Ärger registriert. Soll hierdurch die unauflösbare Ambivalenz zwischen der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und einem sozialen Eingebundensein einerseits und dem Privileg der Zurückgezogenheit des Individuums anderseits ausgedrückt werden? »Ich habe Sehnsucht nach Gemeinschaft, weil es zum Einzelgänger nicht reicht« hieß es schon in »Sieben Tage«. Gegen Ende seines Rom-Aufenthalts wird er Altiero Spinelli zitieren, der während des Zweiten Weltkriegs ein Manifest verfasst hatte, »das im Egoismus der Einzelnen großen Schaden für alle voraussah«.
Die Reflexionen des Protagonisten machen auch vor soziopolitischen Implikationen nicht halt. So versucht er ein wenig fassungslos die steigende Faszination in Italien von Mussolini zu ergründen. Italienischer Nationalismus? Nun, »man gibt nichts auf Rom, auf seine überbezahlten Politiker und seine korrupte Bürokratie. […] Man liebt das Land, aber hasst den Staat, so lautet die Faustformel in Italien.« Und süffisant über Deutschland: »Vor der Nation zucken die Verwalter zusammen, reden lieber von Menschen als von Bürgern und halten bei Auschwitz den Atem nicht mehr an. Strategien machen die Ordnung, Beratung ersetzt das Gespräch, behauptete Eigenart übertrumpft kritische Empfindung. War Deutschland am besten nicht immer das: Eine Pflanzschule für Bewusstsein und Fühlvertrauen, Kant und Novalis. Heute ist es ein Land, dem die ganze Welt begegnet. Dem so viel passiert, das aber nichts davon hält. Es fehlt die Verarbeitung, das Einmachen der Erfahrung.« Heute, so möchte man dem Ich-Erzähler zurufe, muss man schon dankbar sein, wenn jemand Kant und Novalis kennt.
Auch die vermeintliche Heilanstalt Rom verliert seinen Glanz. Der Direktor der Bibliothek Hertziana ist hier der Kronzeuge: »Rom stehe für das alte Europa, für Nachahmungseifer, Verehrungslust, Geschichtsphilosophie. Für Melancholie und Demut auch. Das passe nicht zu den neuen Forschungsprogrammen: Die Geschlechterfrage lasse sich mit einer Arbeit zu Rom nicht beantworten, nach antikolonialistischen Gewährsmännern suche man unter den Nazarenern vergebens«. Und ein Schauspieler sagt ihm, Rom sei verloren, der »Müll, die Straßen, der Nahverkehr – alles kaputt, aus und vorbei, für immer und ewig, mai e poi mai. Er […] hasst den Lärm, die Massen, das Kämpfen.«
Am Ende – erneut ein versteckter Goethe-Rekurs – bleiben nur noch die Steine. Sie werden zu Monumenten der Dauer, zu »Großarchivaren«, denn »sie waren immer schon hier, sind ewige Zeugen des Geschehens.« Sie haben alles ausgehalten: Kaiser, Päpste, »Arkadien«-Träume, die Mafia, Faschismus, Berlusconi, den Müll. Und nun? »Römische Tage. Jenseits aller Wirklichkeit. Dem Gegenteil verschrieben«, so heißt es nach zwei Monaten Aufenthalt, kurz vor der Abreise, bilanzierend. Er reist ab, um sich dann in der Abwesenheit der Stadt Rom wieder »sehnen« zu können. »Nach dem Licht, dem Rauschen, dem innigen Glück.«
Strauß’ zeitgenössische Befindlichkeitsprosa, die die Suche einer apollinisch-freudlos dressierten Akademiker-Wohlstandsexistenz nach Lebenslust, oder, wie es neudeutsch heisst, nach Relevanz, zeigen möchte, trifft in den besten Stellen einen wahren Kern, lässt dann den Leser aufschauen. Aber sie wird zu oft konterkariert von einer fast hochmütigen Larmoyanz des Protagonisten. Dass er dies erkennt, macht es einigermaßen erträglich.
»Wenn alles Staunen aufgebraucht ist, bleibt nur das Rechthaben übrig.« Ein Befund, der gesellschaftlich derzeit en vogue zu sein scheint, denn Rechthaber gibt es genug. Aber was, wenn man nicht Rechthaben möchte? Man muss sich Simon Strauß’ Figuren als rastlose und verzagte Menschen vorstellen.

»»Wenn alles Staunen aufgebraucht ist, bleibt nur das Rechthaben übrig.« Ein Befund, der gesellschaftlich derzeit en vogue zu sein scheint, denn Rechthaber gibt es genug. Aber was, wenn man nicht Rechthaben möchte? Man muss sich Simon Strauß’ Figuren als rastlose und verzagte Menschen vorstellen.«
Ach ja, und dann?
Martin Seel hat gerade ein Buch über das Nicht-Rechthaben wollen veröffentlicht.
Es ist mekwürdig, Gregor Keuschnig, einem Autor vorzuhalten, dass er Menschen schildert, die beim Schachspielen einen Fehler machen. – Und in dem von Ihnen aufgerufenen Kontext des Rechthabens auch ein wenig unfreiwillig komisch, ehrlich gesagt. Es wirkt jedenfalls so, als ob Sie die Pointe von Strauß’ geschildertem Schach-Fehler nicht verstanden hätten: Die Gemeinschaft, die die Gelassenheit stiftet, solche Fehler eben nicht zu kritisieren, oder zu verbergen, sondern sie sozusagen gelten zu lassen.
Ich fürchte sogar, dass Strauß genau dieses sprechende Detail und seine erzählerische Haltung dazu für sozusagen prototypisch unfaschistisch ansieht und genuin menschlich, ja sogar barmherzig (=christlich). So gesehen, wären Sie ihm in die Falle getappt. Tcha.
Das Buch von Strauss finde ich spannend. Ich denke durchaus an das faustische Motiv vom absoluten Augenblick, oder den Prüfstein von der ewigen Wiederkehr (der Gegenwart), den Nietzsche auflegt.
Die Sprache scheint mir sehr gewählt. Eine Prosa, die so deutlich am Stil und an der Reflexion arbeitet, ist im besten Sinne des Wortes elitär. Vielleicht entspringt daraus ja schon genug Verdammungsgrund für die eher »moralisch begabten« Eliten, die im Tarnmantel der Literaturkritik auf die Suche nach dem eigenen Schatten gehen.
Wie beurteilen Sie (@Gregor) das Gelingen dieser doch sehr hochfliegenden Textur, die philosophische Sentenzen anklingen lässt (»das Einmachen der Erfahrung«), und doch die Suggestion von der unmittelbaren Mitteilungen aufrecht erhalten möchte?!
Ich sympathisiere jedenfalls mit dem apollinischen Irrläufer, das darf ich offen sagen. Da Einzelgängertum und späte Geburt ein hartes Brot ist, wird man etwas Larmoyanz entschuldigen können.
@die_kalte_Sophie
Der »faustische Pakt« mit den Erlebnissen der sieben Todsünden findet sich in »Sieben Nächte«. Dieses Buch fand ich in seiner Suche stimmiger; besonders die Anfangssentenzen sind sehr gelungen. »Römische Tage« wirkt mir ein bisschen zu additiv. Der Autor kann sich nicht entscheiden zwischen Befindlichkeitsprosa und Romerzählung – und versucht beides irgendwie halbherzig.
(Vielleicht liegt das Problem auch darin, dass ich, wie Strauss, glaube, schon alles von und über Rom gelesen und gesehen zu haben. Somit ist kein »erster Blick« mehr da, alles ist schon einmal erzählt.)
Ihre Erklärung über die hyperventilierende Literaturkritik scheint mir treffend zu sein. Strauss wird als »elitär« wahrgenommen. Häufig von jenen, die sich an anderer Stelle dann über die geringe Bezahlung ihrer Artikel beschweren. Tatsächlich könnte man seine Texte auch als Produkte einer postmodernen Müdigkeit (»Neurasthenie« nannte man das um die Jahrhundertwende) lesen. Die ist allerdings immer recht unbeliebt gewesen.
Ich habe mich in den Anfang der Erzählung eingelesen: eine rasche Beweglichkeit von Ort zu Ort, von Wahrnehmung zu Wahrnehmung.
Darin liegt scheinbar das Motiv der Suche, aber ich frage mich, ob das nicht einfach ein »Leseeffekt« ist. Die leichte Sinnkrise (vanitas) verstärkt den Eindruck. Die knappen Sätze tragen stets viel Gewicht, weil der formale Anspruch zu seinem Recht kommen möchte. Zu viel Kies, zu wenig Styropor?!
Aus der Rezension geht auch nicht hervor, ob es sich bei dem Romaufenthalt um eine »Heilkur«, eine sentimentale Flucht oder um eine Sinnsuche handelt. Das ist schon merkwürdig, denn das »Geschweife« scheint dem Text inhärent, ohne das man zu sagen wüsste, was diese Bewegung eigentlich bedeutet.
Ich rätsele noch ein wenig darüber, ob diese Befindlichkeitsprosa nicht ein wenig mehr Emotion vertragen könnte. Das wäre dann im Extremfall Innerlichkeitsprosa, aber genau um die Dosierung geht es. Mir scheint, der Autor traut der Andeutung mehr als der vollen Emotion. Ist das Zurückhaltung, Stil oder Indifferenz?! Ich weiß es nicht.
Für Befindlichkeitsprosa treibt sich m.M.n. der Autor zu viel in der neutralen Ecke herum (wie beim Boxen)... Formal ist das ganz gut, aber das erzählerische Ich wirkt dadurch etwas zu ätherisch. Ein Unerreichbar-werden, hätte Deleuze gesagt.
Ob Heilkur, Flucht oder Sinnsuche bleibt tatsächlich unklar. Mehr Emotion hätte ich nicht ausgehalten, weil dann schnell Kitsch aufkommt. Hierfür ist Strauss zu klug. Ich glaube, er spielt schon mit der Sinnsuche, irgend etwas als zigmillionster Rom-Tourist zu entdecken, was gänzlich neu ist.
Strauss ist ja im wirklichen Leben auch Theaterkritiker für die FAZ. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, im Angesicht der medialen Überflutung neue Affekte und Effekte im Theater zu erzeugen und diese dann als Kritiker zu würdigen, ohne in endlose (und langweilige) Referenzschleifen zu verfallen. Was der Ich-Erzähler in »Römische Tage« beruflich macht, bleibt vollkommen unklar; den Bogen von »Sieben Nächte« zu »Römische Tage« habe ich geschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um zwei verschiedene Protagonisten handelt, ist sehr hoch. Die Gemeinsamkeit läge in der Unentschiedenheit, die Zukunft zu gestalten.
Hm, Heilkur und Sinnsuche kann man durchaus verbinden, Sinn, selbst temporärer, kann (vorübergehend) heilen.
Was mich, ohne das Buch zu kennen, wundert: Ist es denn kein Thema, dass die Anschauung selbst von Wert ist und alles Gesagte, Fotografierte und Gelesene, diese nicht ersetzen kann?
Habs nicht gelesen, glaube aber zu wissen, wie schwierig es ist, als deutscher Autor etwas über Rom zu schreiben. Da ist dieses wunderbare Stipendium in der Villa Massimo, wo die werten Autoren in vollkommener Abgeschiedenheit mitten in der Stadt sorgenlos schreiben können. Ganz anders als Eckermann, der in Italien ermordet wurde, oder auch Goethe, der in gewisser Weise auf der Flucht war. Gibt es heute nicht schlicht und einfach das Problem der Stipendiatenprosa und der ausgetretenen Wege? Rolf Dieter Brinkmann hat in solchem Kontext den bösen Buben gespielt und Rom, Blicke geschrieben. Auch darüber kann man nicht mehr hinaus.
@metepsilonema
Ist es denn kein Thema, dass die Anschauung selbst von Wert ist und alles Gesagte, Fotografierte und Gelesene, diese nicht ersetzen kann?
Es gibt diese oder mindestens ähnliche Momente. Sie sind selten und zeigen sich häufig in Blicken von Fremden oder auf Fremde, mit Personen, mit denen der Erzähler nicht in Kontakt kommt.