Anmerkungen zu einer Handvoll legendärer Sätze
2 – Selig die Armen im Geiste...
»Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich«: einer der zahlreichen berühmten Sätzen, die Christus zugeschrieben werden. Auch der Heiland hat sich also für Dummheit, für geistige Beschränktheit ausgesprochen. Wer aufs Räsonieren verzichtet, kommt leichter ins Himmelreich als die Weltklugen, die Vernünftler, wie Luther sie später nennen sollte. Freilich, wir haben da ein kleines, aber feines Übersetzungsproblem: Welche Art von Geistigkeit ist im Matthäus-Evangelium eigentlich gemeint? Eher die religiöse, der man im Deutschen das Adjektiv »geistlich« zuordnet, oder die verstandesmäßige, mit der wir uns in erster Linie weltlichen Dingen zuwenden? Im griechischen Text steht das Nomen »Pneuma«. Da die altgriechische Sprache ein vorchristlich geprägtes Zeichensystem ist, sollte man doch annehmen, daß der Verfasser des griechischen Textes die zweite Bedeutung im Sinn hatte (Luther verwendet in seiner Übersetzung das Wort »geistlich«). Also Leute, die nicht zu den Klugen, den Studierten, den Schriftgelehrten gehören. Sieht man sich den Kontext an, fügt sich dieser Typus in die Reihe der Seligpreisungen, die die Sanftmütigen, Barmherzigen, Friedliebenden betreffen.
An anderer Stelle erklärt Christus die Kinder zu den bevorzugten Bewohnern des Himmelreichs. Ein kindlicher Geist, ein einfaches, nicht verbildetes Gemüt kann ohne Wenn und Aber erlöst werden. Liest man sich durch die Geschichten vom Menschensohn, so fällt auf, daß er bevorzugt Außenseiter um sich scharte, darunter sogar Verbrecher und Prostituierte, neben Leidenden und Gebrechlichen. Die Unwissenden und geistig Minderbemittelten passen da ins Bild. Der Mystiker Meister Eckhart fand für die von Christus gemeinte Armut folgende Formel: »Ein armer Mensch ist, wer nichts will, nichts weiß und nichts hat.« Arm im Geiste sind für Eckhart jene, die abgelöst sind vom Wissen, nachdem sie sich in ihrer geistlichen Existenz davon freigemacht haben. Er gesteht zu, daß es im weltlichen Leben um Lieben und Erkennen geht, doch der Schritt zur Erleuchtung setze den Verzicht auf diese menschlichen Fähigkeiten voraus. Man kann sich kaum einen schärferen Gegensatz zu Eckharts Idealfigur vorstellen als den smartphoneabhängigen digital native, der zu jeder Tages- und Nachtzeit Suchmaschinen, Enzyklopädien, Informationsdienste, Übersetzugsalgorithmen benutzt. Freilich, man kann das auch andersrum sehen: Der digitalisierte Mensch braucht gar nichts zu wissen, da die meisten intellektuellen Funktionen von Maschinen und Rechnern übernommen worden sind. In gewisser Weise ist der Smartphone-Maniker ein Armer im Geist, der Geistigkeit und Gedächtnis von sich abgetrennt hat und sich nun eigentlich höheren Dingen zuwenden könnte – wenn er nur Lust dazu hätte. Tatsächlich wendet er sich billigen Vergnügungen zu, also weltlichen Formen der Dummheit.


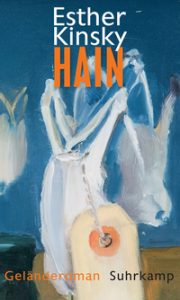
![goya-die-erschiessung-der-aufstaendischen Francisco de Goya: "Die Erschießung der Aufständischen" - Francisco De Goya de España [Public domain], via Wikimedia Commons (Quelle)](https://www.begleitschreiben.net/wp-content/uploads/2018/03/goya-die-erschiessung-der-aufstaendischen-800x617.jpg)