Zunächst einmal: Was für ein erfrischender Beitrag! In der »Welt« schreibt der Schriftsteller Rolf Schneider einen Appell, ja fast eine Philippika, gegen das, was seit ungefähr zwanzig Jahren grosse Teile des deutschsprachigen Theaters in Geiselhaft genommen hat: Das sogenannte »Regietheater«, also jene Form der Inszenierung, in der Regisseure ihre privaten Neurosen auf die Bühne stellten, unter bevorzugter Benutzung von Texten, die sich einer solchen Interpretation widersetzten, weswegen man dieselben zerschlagen muss.
Provokantes
Stringtanga vs. Unterhose
Alice Schwarzer irrt, weil sie den letzten Satz nicht gelesen hat: In dem Artikel von Iris Radisch in der ZEIT über die neueste Anti-Pornographie-Kampagne der »Emma«-Herausgeberin dreht Radisch mehrere rhetorische Pirouetten, landet dann in den Armen des »Bild«-Girls – aber (und hier irrt Frau Schwarzer eben) sie stimmt ihr nicht zu: Die Kälte, die eine Durchsexualisierung der Gesellschaft zur Folge hat, lässt sich mit den alten Waffen des Geschlechterkampfes nicht mehr besiegen steht da. Heisst übersetzt: Frau Schwarzer, das schaffen wir auch ohne ihre antiquierten Methoden.
Der fatale Fehlschluss
In jeder Diskussion um Verbesserungen des Bildungssystems in Deutschland fällt nach wenigen Sätzen fast unausweichlich die Behauptung: In keinem anderen Land (der OECD) bestimmen die Herkunft und die finanziellen Mittel die Bildungschancen derart stark wie in Deutschland. Kinder aus Arbeiteraushalten oder anderen »prekären« Milieus haben – so die These – systembedingt schlechtere Chancen auf höhere Schulabschlüsse wie beispielsweise das Abitur oder gar ein Studium. Der Schluss hieraus lautet, dass Haushalte mit grösseren pekuniären Mitteln per se eine bessere Bildung für ihre Kinder erreichen. Dies bedeutet auch, so die gängige Meinung, dass »ärmere« Kinder bedingt durch ihre »Armut« schlechtere Bildungschancen hätten.
Neben den gängigen OECD-Studien wird auch die PISA-Studie hier immer wieder zitiert. Befragt wird diese These und vor allem ihre Erhebungsmethode gar nicht mehr; sie ist derart kanonisiert, dass es offensichtlich ein Faktum zu sein scheint.
Dabei müssten diese Thesen eigentlich verwundern, denn in Deutschland existieren weder Schulgeld noch Zugangsbeschränkungen, die an finanzielle Zuwendungen gebunden wären (lässt man jetzt einmal die wenigen privaten Internatsschulen beiseite). Wie wird eigentlich genau diese Aussage belegt? Und: Stimmt es tatsächlich in dieser Einfachheit, dass die ökonomische Ausrüstung des Elternhauses den Grad der Bildung bestimmt?
Ein globales Toledo
Unter dem Eindruck des damals heftig tobenden »Karikaturen-Streits« schrieb Botho Strauß Mitte Februar 2006 einen auch heute noch höchst interessanten, eigentlich erstaunlich wenig diskutierten, kurzen Aufsatz im »Spiegel« mit dem lakonischen Titel »Der Konflikt«.
Lässt man Strauß’ gelegentlich unterschwellig anklingende, pessimistische Sicht hinsichtlich einer in nächster Zeit bevorstehenden »Mehrheitsverschiebung« einmal beiseite (freilich klarstellend, nicht die Köterspur des Rassismus bedienen zu wollen), so bleibt eine prägnante Diagnose:
Wie oft beschrieben, bezieht der Islam seine stärkste Wirkung aus seiner sozialen Integrationskraft. Seine diesseitigen Vorteile lässt man leicht außer acht, wenn man sich mit dem politisch-spirituellen Konflikt beschäftigt.
Ende einer Freundschaft
Ich kenne diese öden, langweiligen Diskussionen, währenddessen friedliebende und sich einander respektierende Menschen in wenigen Augenblicken mutierten zu feindseligen, auf immer zerstritten mit denen, die sie noch vor wenigen Stunden Freunde genannt hatten: Es geht um das Pro und Contra dessen, was man (ungenau) Todesstrafe nennt und in den 70er und 80er Jahre das beliebteste Referendarsdiskussionsthema gewesen sein muss.
Konnte man doch in der sicheren Hülle einer demokratischen Gesellschaft seine politisch-korrekte Ächtung monstranzähnlich immer aufs Neue unter Beweis stellen und es all denjenigen zeigen, die sich der kategorischen Festlegung auf einer der scheinbar unverrückbaren Pole entziehen wollten (meistens versuchten sie dies anfangs argumentativ, um dann – nach kurzer Zeit – vom Wortschwall niedermoralisiert zu werden). Selektive Wahrnehmungen hatten auch damals schon Konjunktur.
Gunnar Heinsohn: Söhne und Weltmacht
Die bereits in 2003 von Gunnar Heinsohn entwickelten Thesen zur Bevölkerungsentwicklung und deren eminente Bedeutung wurden Ende Oktober 2006 im »Philosophischen Quartett« des ZDF vorgestellt. Die ansonsten recht strukturiert und statisch von Peter Sloterdijk und Rüdiger Safranski moderierte Sendung geriet ein bisschen aus den Fugen, da Heinsohn, schlagfertig, ironisch und gelegentlich ein bisschen raunend Widerspruch provozierend, die Diskussionsteilnehmer in den Bann zog und im Laufe der 60 Minuten dann alle seinen Schlussfolgerungen erlagen.
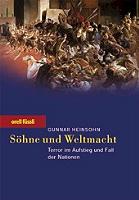
Die Kernthese Heinsohns ist ziemlich einfach: In Gesellschaften mit überzähligen jungen Männern besteht die grosse Gefahr, dass diese jungen, wütenden [zornigen] und ohne Karriereaussichten Zweit‑, Dritt- und Viertsöhne (der erste, älteste Sohn ist durch Erbfolge abgesichert) ihre Perspektive anderswo suchen und es zu blutigen Expansionen und zur Schaffung und Zerstörung von Reichen kommt.
Heinsohn führt den Begriff des children bulge und des youth bulge* ein. Unter children bulge versteht er den Überschuss in einem prozentualen Verhältnis der Kinder unter 15 Jahren in einer Gesellschaft (bzw. einer Nation oder Region oder der Weltbevölkerung). Aus dem children bulge entsteht dann der sogenannte youth bulge; so nennt er die 15–24 jährigen (in vielen Gesellschaften beginnt das Kriegeralter bei 15 Jahren). Aus dem children bulge lässt sich das »Rekrutierungspotential« der »Zornigen« ablesen.
Abseits des Alarmismus
Die wohl kaum als gesellschaftlich progressiv eingeschätzte, CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung hat eine erhellende Untersuchung über das von vielen Alarmisten so bedrohlich empfundene Tragen von Kopftüchern bei islamischen Frauen in Deutschland mit dem interessanten Titel »Das Kopftuch – Entschleierung eines Symbols?« veröffentlicht..
Die Studie kommt zu einem für viele sicherlich verblüffenden Schluss:
»Ich bin alles andere als ein Feigling« – André Müller im Gespräch mit Arno Breker 1979
Nicht nur, aber auch in diesem Beitrag wurde die kürzlich eröffnete Ausstellung in Schwerin von Arno Breker thematisiert. Man kann viel dafür und viel dagegen sagen – bildende Kunst gehört nicht zu meinen Spezialthemen. Vielleicht bringt das Interview mit Arno Breker von 1979, geführt von André Müller ein bisschen Licht ins Dunkel.
Wie fast alle Müller-Interviews ist auch dieses sehr intensiv; nicht selten brechen die Interviewten das Gespräch irgendwann ab, da Müller an Grenzen geht; sie gelegentlich überschreitet. Legendär seine Gespräche mit Elfriede Jelinek oder Wolfgang Koeppen.
