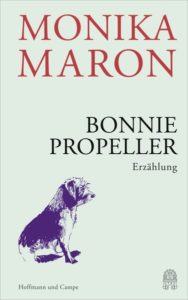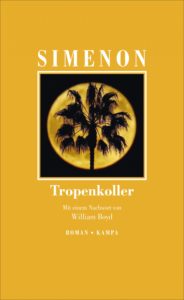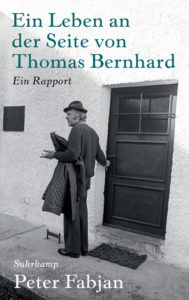
Auf Twitter gibt es einen Teilnehmer, der sich »Thomas Bernhard« nennt und ein Foto des 1989 verstorbenen Schriftstellers im Profil trägt. Er folgt nur drei anderen Teilnehmern (einem Twitter-Nachrichtenportal zu Thomas Bernhard sowie dem Residenz- und dem Suhrkamp-Verlag; merkwürdigerweise nicht Jung und Jung) aber ihm folgen über 6.700 User. Der Name ist »dailybernhard« und so gibt es seit Mai 2015 auch mehr oder weniger regelmäßig einen Spruch von T.B. aus irgendeinem seiner Bücher oder den zahlreichen Interviews. Die Angabe der jeweiligen Quelle unterbleibt; einen Kontext gibt es damit naturgemäß nicht. Von der rechtlichen Komponente einmal abgesehen, stellt sich vor allem die Frage, wem damit gedient ist. Vermutlich steckt dahinter ein Thomas-Bernhard-Schwärmer, jemand, der sicherlich zu jeder (welt-)politischen Lage (woher auch immer) ein treffendes Zitat seines Meisters anbringen kann. Das ist unterhaltsam, keine Frage. Aber es reduziert das Werk eines Dichters auf das Niveau eines Aphorismusschreibers, der zum Beispiel bisweilen gelungen den österreichischen Bundeskanzler zu karikieren scheint, obwohl der in Wirklichkeit noch nicht einmal drei Jahre alt war, als Thomas Bernhard starb.
Egal, werden die Bernhard-Enthusiasten sagen, Hauptsache, der Dichter bleibt präsent. Denn inzwischen hat so ziemlich jeder, der in seinem Leben mit Thomas Bernhard (1931–1989) etwas zu tun hatte, über ihn berichtet und enthüllt. Da ist es nur logisch, dass Bernhards Halbbruder, der ehemalige Internist und Nachlassverwalter Peter Fabjan (*1938), jetzt endlich auch seinen »Rapport« abgibt. »Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard« ist der Titel dieses Büchleins, das mit zahlreichen Fotos ausgestattet, vor einigen Tagen im Suhrkamp-Verlag erschienen ist.
Fabjans Buch ist allerdings weniger ein Rapport als eine Textsammlung. Ausführlich werden die Familienverhältnisse unter denen Bernhard aufwuchs geschildert. Die Mutter starb früh und war psychisch labil; der leibliche Vater, der die Vaterschaft nie anerkannt und ebenfalls früh starb, ein Trunkenbold. Fabjan widmet jeder Person bis hinein in die Tanten und Onkel eine skizzenhafte Lebensbeschreibung. Er konstatiert tragödienhafte Züge in der Familiengeschichte.