Gesetze auf ihre Verfassungstauglichkeit zu überprüfen, ist seit vielen Jahren fast zur Routine geworden. Längst gilt das Bundesverfassungsgericht als die letztbegründende Instanz unter anderem für Datenschützer, Bürgerrechtler, Verfassungsinterpreten und Parlamentarier. Insbesondere Gesetze und Richtlinien, die mittel- oder unmittelbar mit der EU zu tun haben, landen regelmäßig in Karlsruhe (man fragt sich zuweilen, wann eigentlich Peter Gauweiler mal nicht geklagt hat). Fast immer enden die Verhandlungen in mehr oder minder starke Rüffel für die Gesetzgebung. Schlampig gearbeitet, Fristen verstreichen lassen, ungenau formuliert, Institutionen übergangen – die Liste ließe sich noch beliebig erweitern. Die Urteile sind in der Regel populär, weil sie dem Empfinden vieler Bürger entsprechen.
El Greco in Düsseldorf
»El Greco und die Moderne« – so heißt die Ausstellung im Düsseldorfer »Museum Kunstpalast« (noch bis 12. August). Rund 3 Millionen Euro kostet dieses Spektakel. Kein Wunder, dass auch am obligatorischen Freitag, dem Montag, die Ausstellung geöffnet ist. Am Wochenende dürfen die Massen als Ausgleich dafür, dass es voller ist auch 14 Euro (statt 12) bezahlen (Ermäßigungen entsprechend).
Leer war es auch an diesem Mittwoch Nachmittag nicht. Man sah mindestens zwei kopfhörerbewaffnete Schauer, die ihren in Mikrophone sprechenden Führern folgten (die Interpretations-Beschallungen gehören wohl der Vergangenheit an). Andere fuchtelten mit Geräten herum, die wie etwas zu groß geratene Mobiltelefone aussahen. Für 3 oder 4 Euro Mietgebühr kann man sich hier ausgewählte Bilder erklären lassen. Wie immer waren diejenigen, die mir am besten gefallen haben, nicht dabei. Die groß avisierte kostenlose App (»mit Audioguide«) konnte im Museum mangels Empfang nicht geladen werden. Draußen brach sie dann zusammen. Auch noch ein Versuch zu Hause misslang; die fast 90% schlechten Bewertungen sind berechtigt.
Holm Sundhaussen: Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten 1943–2011
Am Ende seines Buches über »Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten 1943–2011« knüpft Holm Sundhaussen, Professor für Südosteuropäische Geschichte an der Freien Universität Berlin und Co-Direktor des Berliner Kollegs für vergleichende Geschichte Europas, an seine Bemerkung vom Anfang an: Nicht »die Geschichte« ist es, die sich wiederholt. Der Mensch wiederholt sich. Dies sei die wichtigste Lehre, die ...
Ein bisschen Handelsblatt, ein bisschen Bundesbank – und ganz viel FAZ und FAS
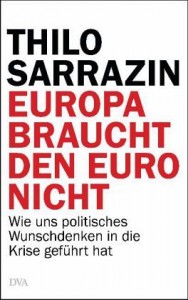
Wie wäre das eigentlich: Ein Buch von Thilo Sarrazin erscheint – und niemand regt sich darüber auf, bevor er es nicht mindestens gelesen hat?
Schwierig wohl, denn die Wellen zu »Deutschland schafft sich ab« schlagen heute noch hoch. Dabei war es nicht damit getan, Sarrazin an einigen Stellen seinen biologistischen Unsinn vorzuhalten und abzuarbeiten. Man benutzte diese Stellen, um das, was in dem Buch ansonsten angesprochen wurde, per se zu diskreditieren. Bei einem zweiten Buch – zu einem vermeintlich anderen Thema – soll nun diese Vorgehensweise perfektioniert werden. »Halt’s [sic!] Maul« protestiert man dann auch schon vorher – und beweist eine bemerkenswerte Diskussionskultur. Als die Protestler am 20.05. vor der Fernsehsendung »Günther Jauch« entsprechend demonstrierten (Sarrazin war dort zum Gespräch mit Peer Steinbrück geladen), dürften sie unmöglich das Buch gelesen haben, um das es in der Sendung ging. Ihnen und auch den Beobachtern der »Nachdenkseiten« stört so etwas nicht: Im Zweifel haben sie sich schon eine Meinung gebildet bevor das, was sie das, was sie kritisieren, überhaupt kennen. Denn sie wissen es ja: Ein »Rassist« und ein »rechter Sozialdemokrat« im Gespräch – da kann nichts rauskommen. Dabei reagieren sie wie Pawlowsche Hunde und ersetzen Intellekt bereit- und freiwillig mit Affekt.
Ich hatte am Mittwoch (16.05.) ein Leseexemplar vom Verlag zugeschickt bekommen. Es ist kaum möglich, innerhalb von vier Tagen das Buch vernünftig zu lesen, durchzuarbeiten und ein konzises Urteil zu fällen. Und obwohl ich davon ausgehe, dass Leute wie Steinbrück eine etwas längere Zeit zur Verfügung hatten, merkte man dem Gespräch an, dass der Contra-Anwalt erhebliche Lücken offenbarte, was Sarrazins Buch anging und der Autor mit seinen Entgegnungen entsprechend kontern konnte.
Handstreich in Düsseldorf
So macht man das in Düsseldorf: Unliebsame und unpassende Anschauungen werden einfach je nach Bedarf entfernt. Wieder einmal geht es um den Heinrich-Heine-Preis, den die Stadt Düsseldorf alle zwei Jahre vergibt. Die unwürdigen und lächerlichen Versuche, mit der die Stadtpolitik 2006 die Umsetzung einer autonome Jury-Entscheidung für Peter Handke verhindern wollte, sind noch allseits nachzuschlagen (beispielsweise hier, hier und hier). Handke beendete das unwürdige Spiel, mit einem launigen Text, der den Verzicht suggerierte.
Sechs Jahre später geht es um die Besetzung der Jury für den Heine-Preis. Nach dem Fiasko 2006 war die Jurybesetzung in einer Satzungsänderung derart verändert worden, dass 15 von 17 Juroren direkt oder indirekt von der Politik bestimmt sind bzw. politische Funktionen ausüben. Die Regelung, dass die Stimmen der Fachjuroren eine höhere Wertigkeit haben, wurde ebenfalls abgeschafft. Zum aktuellen Preis setzte die regierende CDU/FDP-Koalition eine Satzungsänderung durch, in der auch die »Freien Wähler«, die mit nach dem Übertritt eines »Republikaners« mit drei Mitgliedern im Rat der Stadt sitzen, ein Recht auf einen Juryplatz beanspruchen durften. SPD, Grüne und Linke stimmten dagegen – sie befürchteten offenbar, mit dem »bürgerlichen« Übergewicht nicht genügend Einfluss zu haben.
Jetzt ging der Ärger richtig los.
Urheberrecht und geistiges Eigentum. Versuch einer knappen und grundsätzlichen Näherung.*
Beide Begriffe, Urheberrecht und geistiges Eigentum, sind nicht als zeitlos gültige Festschreibungen zu klären, sondern innerhalb einer konkreten Gesellschaft, ihrem »Weltbild«, ihrer Kultur, ihren Wertvorstellungen, ihren ökonomischen Praktiken, ihren technischen Möglichkeiten und dem gelten Recht. Es ist nicht nur denkbar, dass andere Zeiten oder Menschen nach anderen Lösungen verlangen oder sie nahe legen, das war gewiss so und wird wieder der Fall sein. Das ist meine erste Annahme.
Die PR-Aktivitäten der Julija Timoschenko
Eine wahre PR-Schlacht sei da im Gange, kommentiert die ARD-Hörfunkkorrespondentin Christina Nagel – und da hat sie recht. Der »Westen«, d. h. diejenigen, die sich als konsequente Verteidiger der Menschenrechte gerieren (wenn es sich nicht gerade um Wirtschaftsgiganten wie China handelt), sind geradezu entzückt von dieser Konstellation: Hier die Gute, die arme und kranke ehemalige Präsidentin Julija Timoschenko – und dort der böse, diktatorische Russenfreund Janukowitsch. Timoschenko ist wegen Amtsmissbrauchs in Haft (und mit ihr etliche Mitglieder der ehemaligen Regierung). Ihr Prozess sei, so hört man überall, »politisch motiviert«. Suggeriert wird damit: Frau Timoschenko ist in Wirklichkeit unschuldig und wird nur aufgrund ihrer konträren politischen Ansichten eingesperrt.
In Nebensätzen heißt es häufig: Timoschenko war kein Engel. Soll heißen: Sie hat durch Egozentrik und Narzissmus jahrelang die Chancen der »Orangenen Revolution« verspielt. Fast fünf Jahre währte der politische Streit mit dem anderen Protagonisten dieser Revolution, Wiktor Juschtschenko. Präsident und Ministerpräsidentin blockierten sich mit ihren konträren Politikentwürfen zum Schaden des Landes. Timoschenko ging 2009 sogar ein Bündnis mit ihren Erzrivalen Janukowitsch ein, um ihre Macht zu festigen bzw. zu erhalten. Der Pakt hielt nicht lange. 2010 verlor sie schließlich in der Präsidentenstichwahl knapp gegen Janukowitsch. Die Diskussionen über das Wahlergebnis sind schier endlos; am Ende gibt es acht Varianten. In allen hatte Timoschenko verloren – die jedoch das Resultat nicht akzeptieren wollte. Schließlich galt sie selbst in den Einschätzungen ihr lange Jahre wohlwollender US-Kreise als »destruktiv« und »machthungrige Populistin«. Sie wolle, so die Einschätzung von US-Diplomaten in Kiew, lieber ein Opfer sein, als eine Verliererin« Und im Volk wurde aus »Unsere Julija« die »kleinere von zwei Übeln«.
»Ins Helle, in den Tag«
Über den großartigen Dichter Florjan Lipuš und sein funkelndes Sprachkunstwerk »Boštjans Flug« [...] Nur ganz kurz, zu Beginn, wird da scheinbar eine Märchenwelt erzählt. Ein Naturidyll evoziert. Man wird in den (fiktiven) Ort Tesen versetzt und begleitet einen Jungen mit dem Namen Boštjan bei Gehen über die Wege des Waldes. An der Kreuzung zum auch ...
