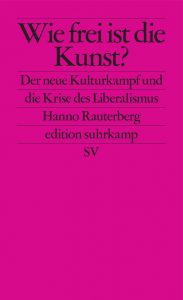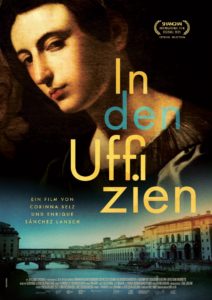
Fast 500 Jahre existieren die Uffizien, die umfangreichste Kunstsammlung der Renaissance, in Florenz. Sie haben Revolutionen, Kriege, Anschläge und Seuchen überstanden. Corinna Belz, die insbesondere mit ihren einfühlsamen Filmportraits über Gerhard Richter und Peter Handke einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde und Enrique Sánchez Lansch, in dessen filmisches Œuvre viele Musikdokumentationen zu finden sind, haben binnen 13 Monaten in 11 Drehblöcken einen Film zu dem zweitältesten Museum der Welt gedreht. Ein Glück war, dass die Dreharbeiten 2019 vor der Pandemie endeten.
Es gibt mindestens drei Hauptdarsteller in diesem Film, der am 25. November in die Kinos kommt. Zum einen die Mitarbeiter des Museums, allen voran der (deutsche) Direktor Eike Schmidt, der die Uffizien seit 2015 leitet. Man sieht ihn, wie er einen Hintergrund für eine Neugestaltung von Sälen aussucht, mit Mitarbeitern Visitenkarten konzipiert, Blickachsen überprüft, der Reinigung eines Gemäldes beiwohnt, zahlungskräftige Spender der »Friends of the Uffizi Gallery« (Postadresse Florida, USA) durch neu zu restaurierende Säle führt und eine Figur des zeitgenössischen Künstlers Antony Gormley ausrichtet, die in einer ständigen Ausstellung integriert werden soll. Letzteres gestaltet sich schwierig, weil die Vorstellungen des Künstlers und den Gegebenheiten des Gebäudes (die Figur wiegt 500 kg!) nicht sofort in Übereinstimmung zu bringen sind. Schmidt wirkt wie ein Fels und zugleich erfrischend unspektakulär. Fließend sein italienisch, welches, wenn es sein muss, in ein amerikanisch getauchtes englisch übergeht. Er kümmert sich darum, wenn es kein Licht gibt, der Aufzug wieder einmal steckenbleibt und organisiert die Hängung in einem neuen Saal. Und er hat das Museum ins Internet und die Menschen ins Museum gebracht (von 2,2 Millionen für die Uffizien ist die Rede – natürlich vor der Pandemie).
Aber auch andere Personen kommen zu Wort, wie der Leiter der Bibliothek, Claudio di Benedetto, der Depot-»Chef« Demetrio Sorace oder der leitende Architekt, Antonio Godoli. Man bekommt einen kurzen Einblick in die Restaurierungswerkstatt von Daniela Lippi, die ein Gemälde Stück für Stück wieder zusammensetzt, welches bei einem Anschlag der Mafia 1993 praktisch zerstört wurde (nicht nur Taliban und IS zerstören Kunstwerke). Bei dem Anschlag gab es fünf Tote. Der Saalaufseher Giuseppe Rizzo erzählt vom Glück, in mitten dieser Kunstwerke Dienst zu tun. Im Gegensatz zu deutschen Museen ist in den Uffizien das fotografieren gestattet (allerdings ist der Selfiestick verboten). Fabio Sostegni, der Hausmeister, ist davon ein bisschen betrübt. Er sehe so viele Besucher die hastig ein Foto von einem Kunstwerk machen würden und wenn sie dann eines gemacht hätten, weitergingen für die nächste Fotografie. Sie hätten dann am Ende zwar viele Fotos gemacht, aber die Kunstwerke eigentlich nicht gesehen.