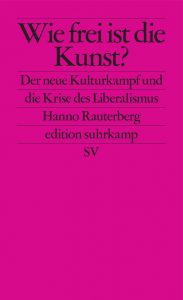1975, als Österreich noch ein konservatives Ländchen und auch in Wien nicht viel los war (ein kultureller Einschnitt war die Besetzung des Schlachthofgeländes Arena 1976), veröffentlichte der Kärntner Schriftsteller Werner Kofler sein Buch Guggile mit dem schalkhaften Untertitel »Vom Bravsein und vom Schweinigeln«. Es war klar, was mit dem Bravsein gemeint war und auf welcher Seite es stand. Inzwischen haben die letzten verbliebenen distanzierten Beobachter den Eindruck, daß sich das Bravsein nach allen Seiten ausgebreitet hat: Pornographie, von Kofler einst künstlerisch genutzt, ist Internetnormalität, die Volksmehrheit bekennt sich zum Atheismus, Vergewaltiger wie auch Grapscher werden stehenden Fußes angezeigt und oft verurteilt, Schwule und Lesben dürfen heiraten, Transpersonen bekommen eigene Klos, Frauen besetzen immer mehr Machtpositionen – als Künstler tut man sich schwer, ein Außenseiter zu bleiben. Ich weiß, es ist noch nicht alles ganz korrekt. Immer noch empfinden Opfer Scham, werden Frauen für gleiche Arbeit ungleich bezahlt, gibt es Armut trotz sogenannter Mindestsicherung. Und die Rechtsextremen, die Populisten, die Nationalisten, oder wie sie genannt werden dürfen, stehen auf der anderen Seite und wachen bigott über das, was man früher unter »Bravsein« verstand. Alle, auf beiden Seiten, fordern »Anständigkeit« ein; viele schwenken bei Demos, für die alle Seiten ihre Gründe haben, eine nationale Flagge; einige, auf der anderen Seite, palästinensische.
In den österreichischen (und deutschen) Buchverlagen wird immer mehr Literatur von Frauen veröffentlicht, und auch in den Redaktionen herrscht diese Tendenz. Beim Klagenfurter Wettlesen gewannen seit 2011 fast nur Frauen den Bachmannpreis. Im Anfangsjahr 1977 war unter den 13 Juroren nur eine Frau, das Verhältnis änderte sich in den Folgejahren wenig. Heute sind die Jurorinnen in der Mehrheit: nur knapp, man kann durchaus nicht sagen, die Männer würden quotenmäßig benachteiligt. Alles gut! Alles korrekt. Alles normal. Weibliche Autoren sind einfach besser.
Manchmal wird trotzdem gestritten, wie neulich im Leykam Verlag, als die Autorin Gertraud Klemm aus einer (rein weiblichen) Anthologie wieder ausgeladen wurde, weil sie Jahre davor einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem sie angeblich die Rechte von – im Korrektheitsjargon – Transpersonen nicht genügend geachtet hatte. Sie wurde nachträglich abgekanzelt und aus der Anthologie ausgeladen. So wie ich hier riskiere, als dogmatischer Incel abgetan zu werden. Für alles gibt es in der Welt der Korrektheiten, links wie rechts, Etiketten. Lydia Mischkulnig, Autorin des Leykam Verlags, sprach hernach vom »totalitären Anstrich« einer Herausgeberinnenschaft, die abweichende Ansichten offenbar nicht haben will. Genauer: Die Herausgeberinnen wollen keine Personen, die bei anderer Gelegenheit etwas ihrer Ansicht nach Unkorrektes geäußert hat. Das ist ein wenig wie Sippenhaftung. Nicht was du jetzt schreibst, ist entscheidend, sondern das, was dein früheres Ich getan hat. Dabei sollten Autoren doch wissen, dass jedes Ich, nicht nur das von Autoren, aus diversen Ichs besteht. Mehr noch, es soll sogar vorkommen, daß schlechte Menschen gute Werke verfassen, oder auch Werke, die ihren politischen Meinungen widersprechen.