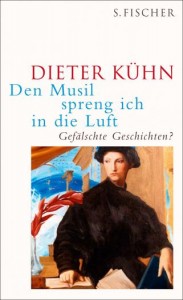
Den Musil spreng ich in die Luft
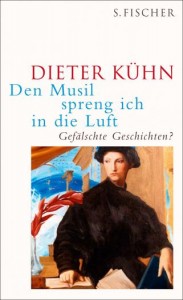
Die Wolken hingen schwer und in Trauben über den orangeroten Dächern beisammen: Julia ging einen Schritt vom Fenster zurück, schlüpfte in ihre Turnschuhe und öffnete die Tür: Sie trat hinaus auf die Straße, überquerte die gepflasterte Fahrbahn, und spazierte gemächlich dahin.
Am Donnerstag beginnen die Bachmannpreislesungen – zwischen Fußball-EM und Olympischen Spielen. Nicht, dass die Veranstaltungen irgendwie zu vergleichen wären, aber ich möchte dann doch für jede mediale Verwendung der Floskel »Wettlesen« – des blödsinnigsten Begriffes, den es für diese Veranstaltung gibt – nur 10 Cent bekommen. Danach könnte ich wohl ein oppulentes Abendessen mit Freunden abhalten.
Man ist ja geneigt, jede Präsenz in den Medien zu einer solchen Veranstaltung (besonders im Vorfeld) zu begrüßen. Aber da man sich leider ein bisschen auskennt, ist die Freude eher gering. Da wird am 1. Juli in einer Literaturgruppe auf Facebook launig gefragt, wer denn den Preis gewinnen »soll«. Die Antworten sind naturgemäß eher fragend. Auf den Hinweis, man kenne die Texte nicht, werden die Links zu den Videoportraits der Lesenden gesetzt. Als würde dies alleine schon etwas über die Qualität der Texte aussagen. Einen Hinweis darauf kontert man patzig, die Regularien würden nun nicht unseretwegen geändert – und nun beginnt man, diese Regularien zu zitieren. Dabei hätte man bei vorheriger Lektüre gemerkt, wie dumm diese Frage nach dem »verdienten« Preis ist, es sei denn, man fällt ein Urteil aufgrund der (zumeist nichtssagenden) Portraitfilmchen. (Nur als Hinweis: Die Beitragstexte sind für die Öffentlichkeit bis zum Zeitpunkt der Lesung nicht zugänglich.) Wobei die Verwunderung über diese Form des Umgangs mit Literatur auch nicht mehr so ganz neuartig ist. Ignoranz als Prinzip. Oder: Wer ist denn heute noch so kleinlich und urteilt aufgrund eines vorliegenden Textes?

Dennoch: Was zwischen zwei Deckeln steht, genießt einen höheren Ruf als eine immer noch als eher »schnöde« eingeschätzte Internetpräsenz. Wilfried Huismann ist noch einen anderen Weg gegangen: zunächst war da ein Film, »Der Pakt mit dem Panda«, der die Praktiken des allseits bekannten und beliebten WWF (»World Wide Fund For Nature«) kritisch befragte. Im Sommer 2011 erstmals ausgestrahlt erzeugte er beträchtliches Aufsehen (eine Verlinkung auf den Film unterlasse ich; jeder möge entsprechende Suchmaschinen konsultieren). Die Wiederholungen einige Monate später in Dritten Programmen der ARD sorgten für zusätzliche Furore. Der WWF reagierte mit einem »Faktencheck« (s. auch hier, hier und hier), um dem Autor Fehler nachzuweisen. Huismann antwortete im Januar 2012 auf die bis dahin geäußerten Vorwürfe auf seiner Webseite. Zum Film erwirkte der WWF mehrere Einstweilige Verfügungen (hier Nr. 1, hier Nr. 2 und hier Nr. 3).
Gesetze auf ihre Verfassungstauglichkeit zu überprüfen, ist seit vielen Jahren fast zur Routine geworden. Längst gilt das Bundesverfassungsgericht als die letztbegründende Instanz unter anderem für Datenschützer, Bürgerrechtler, Verfassungsinterpreten und Parlamentarier. Insbesondere Gesetze und Richtlinien, die mittel- oder unmittelbar mit der EU zu tun haben, landen regelmäßig in Karlsruhe (man fragt sich zuweilen, wann eigentlich Peter Gauweiler mal nicht geklagt hat). Fast immer enden die Verhandlungen in mehr oder minder starke Rüffel für die Gesetzgebung. Schlampig gearbeitet, Fristen verstreichen lassen, ungenau formuliert, Institutionen übergangen – die Liste ließe sich noch beliebig erweitern. Die Urteile sind in der Regel populär, weil sie dem Empfinden vieler Bürger entsprechen.
»El Greco und die Moderne« – so heißt die Ausstellung im Düsseldorfer »Museum Kunstpalast« (noch bis 12. August). Rund 3 Millionen Euro kostet dieses Spektakel. Kein Wunder, dass auch am obligatorischen Freitag, dem Montag, die Ausstellung geöffnet ist. Am Wochenende dürfen die Massen als Ausgleich dafür, dass es voller ist auch 14 Euro (statt 12) bezahlen (Ermäßigungen entsprechend).
Leer war es auch an diesem Mittwoch Nachmittag nicht. Man sah mindestens zwei kopfhörerbewaffnete Schauer, die ihren in Mikrophone sprechenden Führern folgten (die Interpretations-Beschallungen gehören wohl der Vergangenheit an). Andere fuchtelten mit Geräten herum, die wie etwas zu groß geratene Mobiltelefone aussahen. Für 3 oder 4 Euro Mietgebühr kann man sich hier ausgewählte Bilder erklären lassen. Wie immer waren diejenigen, die mir am besten gefallen haben, nicht dabei. Die groß avisierte kostenlose App (»mit Audioguide«) konnte im Museum mangels Empfang nicht geladen werden. Draußen brach sie dann zusammen. Auch noch ein Versuch zu Hause misslang; die fast 90% schlechten Bewertungen sind berechtigt.
Am Ende seines Buches über »Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten 1943–2011« knüpft Holm Sundhaussen, Professor für Südosteuropäische Geschichte an der Freien Universität Berlin und Co-Direktor des Berliner Kollegs für vergleichende Geschichte Europas, an seine Bemerkung vom Anfang an: Nicht »die Geschichte« ist es, die sich wiederholt. Der Mensch wiederholt sich. Dies sei die wichtigste Lehre, die ...
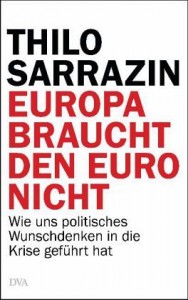
Wie wäre das eigentlich: Ein Buch von Thilo Sarrazin erscheint – und niemand regt sich darüber auf, bevor er es nicht mindestens gelesen hat?
Schwierig wohl, denn die Wellen zu »Deutschland schafft sich ab« schlagen heute noch hoch. Dabei war es nicht damit getan, Sarrazin an einigen Stellen seinen biologistischen Unsinn vorzuhalten und abzuarbeiten. Man benutzte diese Stellen, um das, was in dem Buch ansonsten angesprochen wurde, per se zu diskreditieren. Bei einem zweiten Buch – zu einem vermeintlich anderen Thema – soll nun diese Vorgehensweise perfektioniert werden. »Halt’s [sic!] Maul« protestiert man dann auch schon vorher – und beweist eine bemerkenswerte Diskussionskultur. Als die Protestler am 20.05. vor der Fernsehsendung »Günther Jauch« entsprechend demonstrierten (Sarrazin war dort zum Gespräch mit Peer Steinbrück geladen), dürften sie unmöglich das Buch gelesen haben, um das es in der Sendung ging. Ihnen und auch den Beobachtern der »Nachdenkseiten« stört so etwas nicht: Im Zweifel haben sie sich schon eine Meinung gebildet bevor das, was sie das, was sie kritisieren, überhaupt kennen. Denn sie wissen es ja: Ein »Rassist« und ein »rechter Sozialdemokrat« im Gespräch – da kann nichts rauskommen. Dabei reagieren sie wie Pawlowsche Hunde und ersetzen Intellekt bereit- und freiwillig mit Affekt.
Ich hatte am Mittwoch (16.05.) ein Leseexemplar vom Verlag zugeschickt bekommen. Es ist kaum möglich, innerhalb von vier Tagen das Buch vernünftig zu lesen, durchzuarbeiten und ein konzises Urteil zu fällen. Und obwohl ich davon ausgehe, dass Leute wie Steinbrück eine etwas längere Zeit zur Verfügung hatten, merkte man dem Gespräch an, dass der Contra-Anwalt erhebliche Lücken offenbarte, was Sarrazins Buch anging und der Autor mit seinen Entgegnungen entsprechend kontern konnte.