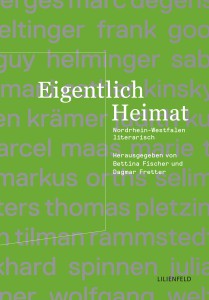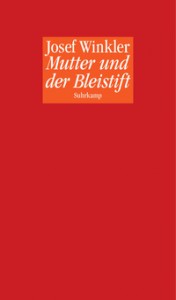Nach dem Fatwa-Text eines gewissen Edo Reents über Judith Hermann (am Rande ging es dort auch um ihr Buch »Aller Liebe Anfang«) gab es aus dem erlauchten Kreis nach zeitlicher Verzögerung nur zwei Stimmen, die sich genötigt sahen zu widersprechen. Die eine ist Iris Radisch in der »Zeit«, deren Text zur Sicherheit erst gar nicht online gestellt wurde. Radisch neigt ja gelegentlich selber zum personalen Übergriff in ihren Kritiken, eine grössere Diskussion wäre vielleicht nicht gewünscht gewesen. Gerrit Bartels kontrastierte dann für den »Tagesspiegel« die »ekelige Doppelmoral« der FAZ im »Fall« von Judith Hermann: Vier Wochen vorher wurde sie in einem Interview noch gefeiert, jetzt verteufelt. »Kann nicht schreiben die Frau, aber als Covergirl brauchen wir sie doch!«, so Bartels’ ziemlich treffende Analyse.
Für die »Welt« hat nun Tilman Krause einen kleinen Text zu Hermanns Buch geschrieben. Der Titel spielt natürlich auf Hermanns erstes Buch »Sommerhaus, später« an und soll Originalität aufzeigen. Dann verpasste man dem Buch das Rubrum »umstritten«. Wie so oft bleibt unklar, was »umstritten« eigentlich bedeuten soll. Dass es divergierende Urteile zu Romanen gibt? Dass Reents’ Unverschämtheit zaghaft kritisiert wurde? Oder dass es sich, wie Tilman Krause sanft insinuiert, um eine Adaption eines Stoffes von Patricia Highsmith handelt?
Immerhin, Krause will wieder zurück zum Buch. Aber mindestens den Einstieg von seinem Text zu analysieren lohnt sich, weil er gewisse Skandaliserungsmechanismen des Literaturbetriebs wie auf einer Petrischale sichtbar macht (alle Kursivsetzungen aus Krauses Text).
Krause beginnt mit einer als Frage gekleideten Feststellung:
Wer hätte gedacht, dass wir gerade Judith Hermann die erste kleine Literaturdebatte des beginnenden Bücherherbstes verdanken würden?
»Wir« (wer ist das genau?) haben also eine »kleine Literaturdebatte«, die »wir« Judith Hermann zu »verdanken« haben. Ist es aber nicht eher so, dass diese »Debatte« darüber geführt wird, wie eine sogenannte Rezension als Autorinnenvernichtungstext daher kommt? Demzufolge hätten wir diese »Debatte« nicht Judith Hermann sondern Edo Reents zu »verdanken«.
Eine »Literaturdebatte« kann man es aber kaum nennen. Zum einen geht es nicht um ästhetische Fragen, sondern (1.) darum, dass Frau H. nicht schreiben kann und (2.) aus einem 220seitigen Text ein paar Stellen gefunden wurden, die isoliert betrachtet, holprig erscheinen.
Eine Literaturkritik-Debatte ist es übrigens auch nicht, weil die Masse der Kritiker nur hochgezogene Augenbrauen zustande bringt und nicht riskieren möchte, es sich mit einem vielleicht demnächst bei der FAZ in prominenter Position sitzenden »Kollegen« zu verscherzen.
Krause kommt in seinem Text auf Reents zu sprechen:
Da diese Frau etwas Existenzielles anspricht, ruft sie aber auch Reaktionen hervor, die über das Rezensorische hinausgehen: »Judith Hermann hat zwei Probleme: Sie kann nicht schreiben, und sie hat nichts zu sagen«, befand, nicht ohne Kopf-ab-Aplomb, Edo Reents in der »Frankfurter Allgemeinen«.
Vorher hatte Krause noch von einer Masche Judith Hermanns geschrieben und er meinte die einfachen Sätze[], die noch dazu voller Wortwiederholungen stecken. Also es muss mindestens Masche heissen, »Methode« reicht nicht.
Aber jetzt plötzlich spricht sie etwas Existenzielles an, dass Reaktionen hervorruft, die über das Rezensorische hinausgehen. Krause macht einen Kopf-ab-Aplomb aus, schreibt aber die »Schuld« daran der Autorin zu, nicht dem Kritikerdarsteller Reents, der, so legt diese Stelle nahe, nur infolge eines Affekts ausfällig geworden sei. Mildernde Umstände sozusagen.
Die Kritik von Iris Radisch bezeichnet Krause als Ordnungsruf. All dies sei innerbetriebliche[s] Hickhack und eigentlich sattsam bekannt.
Dass man einer Autorin öffentlich die Fähigkeit abspricht, Literatur schreiben zu können, halte ich eigentlich nicht für Hickhack und auch nicht für eine Petitesse, über die man als innerbetriebliche Querelen abtun kann. Aber Krause will weg vom Minenfeld Literaturbetrieb und unbedingt seine Entdeckung loswerden.
Liest man »Aller Liebe Anfang« genau, stellt man fest, dass sich das Buch in seiner Struktur an ein berühmtes Vorbild anlehnt, den Psychokrimi »Der Schrei der Eule« von Patricia Highsmith (erschienen 1962).
Immerhin gilt es noch den kleinen Seitenhieb mit dem liest man…genau. Wobei ich mir schon die Frage stelle: Ist das nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit für einen Kritiker »genau« zu lesen? In etwa zu vergleichen mit der Aussage: »Wenn man nicht besoffen Auto fährt…«?
Von nun an aber widmet sich Krause seinem Vergleich zwischen Hermann und Highsmith. Das ist immerhin eine Entdeckung; inwieweit sie zündet, bleibt unklar, da Krause nur nach Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den Büchern im Plot sucht und am Ende beiden Autorinnen bescheinigt sie seien im heutigen Sinne »uncool«. Immerhin.