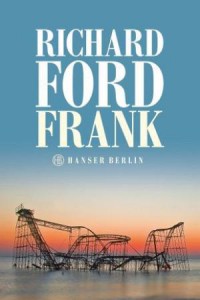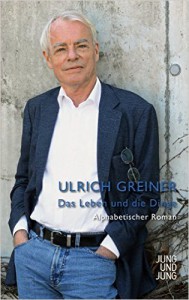In seinen bisher erschienenen drei Frank-Bascombe-Romanen »Sportreporter« (1986/dt. 1989), »Unabhängigkeitstag« (1995) und »Die Lage des Landes« (2006/2007) erzählte Richard Ford nicht nur die persönlichen Ereignisse seiner (fiktiven) Hauptfigur, die in drei Jahrzehnten in einem fast typische amerikanisch anmutenden Pragmatismus so unterschiedliche Berufe wie Schriftsteller, Sportreporter und schließlich Immobilienmakler ausübte, sondern vermittelte immer auch ein entsprechendes zeithistorisches Bild des politischen und sozialen Zustandes der USA. Frank Bascombe musste persönliche Schicksalsschläge überwinden (sein Sohn starb als 10jähriger an dem Reye-Syndrom, was seine Ehe nicht überstand und die Scheidung zur Folge hatte) und dann schien er es November 2000, mit Mitte 50, als »Die Lage des Landes« spielt, endlich »geschafft« zu haben. In den Clinton-Jahren gelang es ihm durch Cleverness, Hartnäckigkeit und Glück in die obere Mittelschicht aufzurücken. Er war neu verheiratet, das Verhältnis zu seinen Kindern normalisierte sich, die Geschäfte liefen hervorragend. Aber dann kam der Prostata-Krebs. Unerwartet auch, als wie aus dem Nichts der ehemalige Liebhaber seiner neuen Frau auftauchte. Und als wäre dies noch nicht genug, wurde er auch noch in eine Schiesserei verwickelt. Der Roman spielt im Interregnum des Jahres 2000 – es war immer noch nicht klar, ob nun Al Gore oder George W. Bush der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika würde. Intuitiv spürt Frank, dass die Zeichen auf Veränderung standen. Vielleicht platzt bald die Immobilienblase. Wie geht es mit ihm gesundheitlich weiter? »Die Lage des Landes« war ein grosses, episches Werk voller Melancholie, aber auch Sinn für die Schönheit des Lebens, einer gehörigen Portion derbem, aber doch gutmütigem Witz und einer filigranen wie lehrreichen Verschmelzung von Familien- und Zeitgeschichte, wie es selten zu lesen ist. Weiterlesen
Bilderstreit
Aufgeschreckt durch die Klage des Mannheimer Museums gegen Wikimedia Foundation und Wikimedia Deutschland wegen der angeblich widerrechtlichen Verwendung von Fotos gemeinfreier Bildern auf ihren Seiten habe ich beschlossen, alle Beiträge, in denen ich Bilder von Kunstwerken verwendet habe, die ich entweder selber abfotografiert hatte oder deren Herkunft unklar ist, zunächst einmal aus dem Angebot des Blogs zu entfernen.
Die Diskussion über den Fall auf heise online zeigt die Vielfalt der möglichen Meinungen. Welche davon ihre Gültigkeit behalten wird und welche nicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Einzig sicher scheint zu sein, dass es hier derzeit keine Rechtssicherheit gibt.
Erkenntnis
Ein Reh nähert sich, umkreist mich langsam, schaut mich von verschiedenen Standpunkten an. Die aufgestellten Ohren bewegen sich vorsichtig, mit winzigen Rucken, fast wie ein Zittern, aber es ist kein Zittern, es sind vorsätzliche Rucke. An den Ohren – mehr als an den fragenden Augen – erkenne ich, wie es von mir denkt. Das Reh vollzieht eine geistige Annäherung, Annäherung und Entfernung, Willkommen und Abschied. Nach einer Weile hat es genug erkannt und zieht sich zurück in den Wald, geht seiner Wege. Ein Gongklang steigt aus der grünen, rot gesprenkelten Tiefe herauf, schwebt in der Klarheit hoch über dem Meeresspiegel und verbindet das Reh und mich für eine weitere (letzte) Weile, als würde sich der Klang im Sichtbaren reflektieren.
Kennst du den Konjunktiv, Reh, die Möglichkeitsform?
Ulrich Greiner: Das Leben und die Dinge
Ungewöhnlich dieses kurze Vorwort in der Er-Form. Es ist der Versuch, noch einmal eine kleine Distanz herzustellen zu dem, was dann unweigerlich »Ich« genannt werden wird. Der Mann, der seine schwarzen Anzüge nur noch zu Trauerfeiern benutzt. Die sogenannten »Einschläge«, die näherkommen. Die Erinnerungen, die immer mehr verblassen und vor dem endgültigen Verschwinden errettet werden sollen. Weiterlesen
Im Schein der Bilder I
VOR HAARLEM

Jacob van Ruysdael: Haarlem von den Dünen im Nordwesten gesehen – via Wikimedia Commons
Die Küste der Freiheit
Wer reist heute noch mit dem Schiff? Niemand. Ein paar Neureiche, die nach dem Luxus vergangener Zeiten haschen. Eine Handvoll Techniker, die die Automatik der Frachter überwachen. Scharen von Habenichtsen, die auf rostigen Kähnen die Festung Europa bestürmen (eine Festung, die sagenhafte Reichtümer birgt).
Das Jahr 1989 verbrachte ich in Sizilien. Es war das Jahr, in dem die Mauer fiel. Jeder weiß, was gemeint ist: die Mauer, die Berlin in zwei Teile teilte; und die nicht fiel, sondern überrannt, ignoriert, zerstört wurde. Eines Morgens im November nahm ich in Trapani den Bus nach Erice. Dieses Dorf liegt hoch über dem Meer, die hinführende Straße macht Serpentinen und Spitzkehren. Außer mir waren nur zwei Fahrgäste im Bus, die mit dem Chauffeur bekannt waren. Während er das Fahrzeug mit der üblichen traumwandlerischen Sicherheit die Abgründe entlang lenkte, blickte der Chauffeur in den Rückspiegel, um die Gesichter der Gesprächspartner im Augenwinkel zu behalten. Er erzählte von den Bildern in den Fernsehnachrichten am Vorabend. Er schien sehr zufrieden zu sein. Die Leute, berichtete er, hatten auf der Mauer getanzt. Das hatte ihm gefallen. Es war ein wunderbares Schauspiel gewesen. Die beiden Fahrgäste, alte, verdorrte Männer, nickten. Sie hatten das Schauspiel versäumt. Ich selbst schaute während der Fahrt auf die Muster der Meeresfläche tief unter uns; die weißen Rechtecke der Salzberge vor der Küste; die dunklen Höcker der Inseln weiter draußen. Ich dachte: Was geht mich das an, Berlin. Ich dachte: Was soll diese Hysterie. Später, abends, sah ich in Erice einen der beiden Fahrgäste still vor seiner Haustür sitzen. Weiterlesen
Lauter Überraschungen
»Alles Lüge oder was?« lautete der fesche Titel der ARD-Dokumentation, die zeigen sollte, »wenn Nachrichten zur Waffe werden«. Klaus Scherer blieb dafür nicht im Lande bei den Redaktionen, untersuchte nicht zum Beispiel deren Berichterstattung zum Irakkrieg 1990/91 (die Brutkastenlüge kam erst ganz zum Schluss für wenige Sekunden) oder den Jugoslawienkriegen von Mitte bis Ende der 1990er Jahre, befragte nicht die von vielen als einseitig wahrgenommene Russland/Ukraine-Berichterstattung oder nahm Stellung zum berühmt gewordenen Foto vom Charlie-Hebdo-Trauermarsch der Regierenden. Letzteres diente nur dazu eine jüdisch-orthodoxe Zeitung in Israel anzuklagen, die aus religiösen Motiven Angela Merkel auf dem Foto wegreouchiert hatte.
Selbstkritik? In homöopathischen Dosen. Lächerlich wie Kai Gniffke ein fehlender Konjunktiv vorgehalten wurde und dieser den Fehler ein bisschen zerknirscht eingestand. Ansonsten ist aber klar: Fälschen tun immer die anderen. Weiterlesen
Lied für heute und morgen
Die Frau mit dem Kopftuch ist wunderschön. Das Tuch, grün und golden, geheimes Muster, rahmt das Gesicht, kehrt seine Schönheit hervor. Es ist eine fremdländische Schönheit, eine aus Irgendwo, Indien oder Afrika oder Mongolei oder Peru, von der Küste, vom Hochland, aus dem Gebirge, man weiß es nicht, sie kommt von einem ganz anderen Erdteil, den wir nicht kennen. Ebenmäßige Züge, schmale Nase, die kaum hervortritt aus dem Gesicht, unmerkliche Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen hier und dort, dir und mir, ich und ich. Eine Versunkenheit. Ein leichtes Aus-sich-Herausgehen. Ein Lächeln in Bereitschaft. Wasserblaue Augen, die plötzlich scharf und dunkel werden. Scharfe dunkle Augen, die plötzlich weich und wasserblau werden. Leicht gewölbte Brüste unter dem weinrotem Stoff. Umriß der Schenkel unter sich spannendem Kittel. Die Knie dort, zwei Festpunkte – kleine Erhöhungen – im Strom. Die ganze Frau ist ein Fels in der Brandung, die anschwillt und abschwillt. Mit ihren beiden Kindern, die jetzt schlafen (und jetzt und jetzt schlafen), links und rechts an der Hüfte der Mutter, eines der beiden Köpfchen im Schoß, sitzt sie am Abgang zur U‑Bahnstation, den aufrechten Rücken ans kupfergrüne Geländer gelehnt, wo die Eiligen eine Kehre machen, einen engen Bogen beschreiben, um gleich darauf zu verschwinden. Wollen sie in die Unterwelt, müssen sie um die Frau mit Kopftuch herum. Keine Aufforderung zum schlechten Gewissen erreicht sie, keine zur Empfängnis der Gabe geöffnete Hand, keine Geste, kein Nicken, nichts. Nur die Augen, die sich von Zeit zu Zeit schärfen, verengen, erweitern. Und vor (oder in) den Augen die flüchtigen Gestalten, fliehend wovor? Und Beine, wehende Hosen, steife Röcke, federnde Füße, spitze Knie. Quiekende, knarrende, atmende Schuhe. Gezwängte Fersen und Zehen. Eingefaltete Gesichter. Geschminkte Gesichter. Selbstvergessene Gesichter. Die Frau merkt sich ein jedes. Sie merkt sich die Gesichter, die jeder Einzelne birgt, nimmt die Gesichter in sich auf, stellt sie in den Speicher, hängt einige an die Wand ihres Museums. Vielleicht ist das ihre selbstgewählte Aufgabe. Von Zeit zu Zeit wechseln die Bilder an den Wänden, die hier kommen in den Speicher, jene werden sich gezeigt.
Aber die Schönheit der Frau vom anderen Erdteil...
© Leopold Federmair