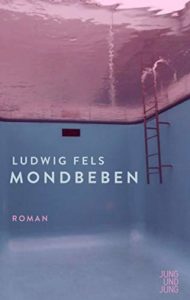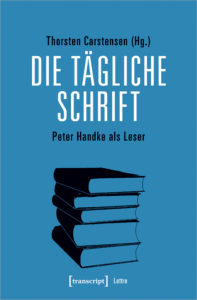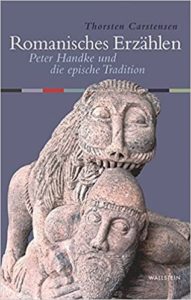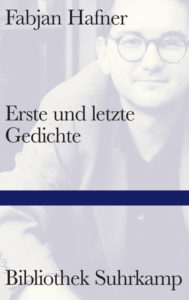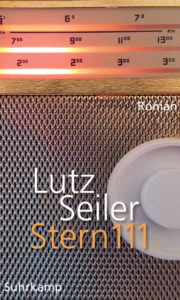Ein Aufbruch in ein neues Leben. Helen und Olav Ostrander, vielleicht irgendwo in den 30ern oder 40ern. Er, früher Inkassoeintreiber im Milieu, der Helen einst vor ihrem Ehemann beschützte, in dem er diesen krankenhausreif schlug. Das war unverhältnismäßig und gab anderthalb Jahre Gefängnis. Aber da schworen sich die beiden schon Treue, heirateten und als er aus dem Knast kam, musste Helen noch mal kurz weg. Sie kam zurück mit dem unverhofften Erbe des Onkels. Es muss viel Geld sein. Sie sahen im Internet in einem fernen, warmen, fiktiven Land (Karibik? Afrika?) ein Haus auf einer vorgelagerten Insel. Nein, es ist mehr als ein Haus, ein Traumhaus. Der neue Anfang. »Geld war das Material, mit dem sich die Existenz panzern ließ, war fast schon eine Droge gegen den Tod.«
So beginnt »Mondbeben« von Ludwig Fels. Fast ein bisschen wie diese Doku-Soaps über Auswanderer, die ihr Glück in fernen Ländern suchen. Aber es wird dann doch eher ein David-Lynch-Film. Helen und Olav sind ein bisschen wie Lula und Sailor – und doch ganz anders. Ihr schnippischer Dialogstil verbirgt nur oberflächlich die Sehnsucht, es geschafft und den richtigen gefunden zu haben. Der Rest des Lebens soll sorglos werden. Und so sind die gegenseitigen Beschwörungen des Glücks besonders am Anfang inflationär, immer wieder Versicherungen »wie schön dies geheime Glück war«, nämlich »zum Verrücktwerden schön«, denn »bald würden die Sterne ihre Lieder singen«.
Und dennoch schwingt von Anfang an so ein unheilvolles Gefühl mit. Sorge, dass es nicht so wird. Sicher, Olav trinkt ein bisschen zu viel, seine Hände zittern bisweilen. Die Hitze ist fast unerträglich und es ist das Land mit den weltweit größten Ratten. Als er im Hotel-Resort »Rosemilk«, in dem die beiden bis zum Bezug des Hauses untergebracht sind, der Prostituierten Assumpta, die von einem Gast geschlagen wird, hilft, bekommt der schöne Schein erste Risse. Der Vertreter der Immobilienfirma (der Mr Moses heißt – überhaupt: diese Namen!), ist Olav unsympathisch und er lässt es ihm auch anmerken. Helen ist ruhiger, möchte ihren Frieden. Ominös die Instruktionen zum Geldtransfer; der ihnen vorgestellte »Notar« wirkt halbseiden. Helen zahlt trotzdem. Und das Drama beginnt. Weiterlesen