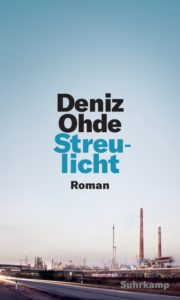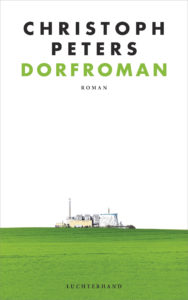(← 2/11)
Im folgenden werde ich eine Reihe von Punkten, von Feststellungen und Erkenntnissen anführen, denen ich lebhaft zustimmen möchte. Und dies in der Absicht, meiner eigenen gesellschaftsbezogenen Wahrnehmung Nachdruck zu verleihen, daß unser tägliches Unbehagen nicht in erster Linie durch einen unberechenbaren, extremistischen, oft religiös motivierten, historisch rückwärtsgewandten Terror bedingt ist, sondern einem Gespinst aus selbstverständlich gewordenen, selten ins Bewußtsein dringenden Gräueln gleichkommt.
Forresters Buch ist nicht wissenschaftlich, es stellt auch nicht diesen Anspruch. Es ist ein Essay, der um eine überschaubare Anzahl von Themen kreist und sich dabei immer wieder Abschweifungen erlaubt. Für ihre Beobachtungen und Erklärungen bringt Forrester wenig konkrete Belege, ihre Ableitungen folgen keiner strengen Logik und keinem akademischen Schema. Trotzdem – oder deshalb? – kann man aus heutiger Sicht sagen, daß sie zumeist ins Schwarze trifft. Man muß kein Wirtschaftsexperte sein, um festzustellen, daß der Finanzkapitalismus sich mehr und mehr von der Produktion realer Güter abgehoben hat und daß daraus erhebliche Probleme entstehen, die nicht nur die Masse der mehr oder weniger Besitz- und oft auch Arbeitslosen schwächen, die Reichen unverhältnismäßig stärken und zu globalen Krisen wie im Jahr 2008 führen können. Man muß kein Fachmann sein, um zu bemerken, daß ökonomische Prozesse in den postindustriellen Gesellschaften wie Glücksspiele ablaufen, bei denen gesetzt, gewettet, gewonnen und verloren wird, wobei die Spieler, die global players, die Einflußfaktoren und Kontexte selbst zu schaffen und zu kontrollieren bestrebt sind (was ihnen aufgrund der Hochkomplexität, der Unüberschaubarkeit, der Hochgeschwindigkeit der Abläufe und der digitalen Selbstläufe nicht immer gelingt), sofern sie über genügend Macht und Geldmittel verfügen. Auch auf die Risiken und unerwünschten Nebenwirkungen der Digitalisierung hatte Forrester bereits 1996 aufmerksam gemacht, auch sie haben in der Krise 2008 Bestätigung gefunden. Massenpsychologische Faktoren beeinflussen finanzwirtschaftliche Entwicklungen auf das stärkste. In gewissem Sinn ist »die Wirtschaft« halluzinatorisch geworden: Während von (»wissenschaftlichen«) Prognosen und (»kalkuliertem«) Risiko die Rede ist »arbeitet« sie mit Hoffnungen und Einbildungen, mit Phantasien und Ängsten. Mediatisierter Sport und Popkultur, die heutigen Glanzstücke jener Kulturindustrie, deren Anfänge einst Horkheimer und Adorno beschrieben, gehören ebenso zu den bevorzugten Einsätzen dieser ökonomischen Abläufe wie die digitalisierte Pornographie, der Handel mit privaten Daten und natürlich die Werbung, die nicht mehr nur dazu dient, Produkte an den Mann zu bringen, sondern selbst ein abgehobener Wirtschaftszweig geworden ist.
Wahrscheinlich ist es, um wirtschaftliche Prozesse zu verstehen, sogar besser, kein Fachmann und keine Fachfrau zu sein, weil man als Außenstehender Abstand hat und sich nicht so leicht in die durch die Digitalisierung verstärkte und zum Dauerzustand gewordene Hysterie hineinziehen läßt. Zumal die sogenannten Ökonomen, geht man nach ihren Kommentaren in Tageszeitung, ohnehin nichts wissen. Glauben heißt nichts wissen (pflegte meine Großmutter zu sagen); die sogenannten Ökonomen sind selbst nur Spekulanten, die an diesem Psychospiel teilnehmen, ob bewußt oder unbewußt, vorsätzlich oder nicht.
Weiterlesen ...