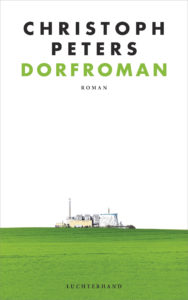
Dorfroman
Einen »Dorfroman« über den Niederrhein, behandelnd die Jahre ungefähr zwischen 1975 und 1982, teilweise gespiegelt aus der Erinnerung durch einen Sohn, der inzwischen in Berlin wohnt und die betagten Eltern (um die 83 Jahre) in ihrem Haus im Dorf zu Pfingsten besucht. Das alles auf 400 Seiten. Wer Action oder Skandal oder beides will, sollte das Buch zur Seite legen. Aber wer sich beispielsweise für Zeit- und Kulturgeschichte der alten Bundesrepublik interessiert, ist hier richtig.
Das Dorf ist Hülkendonck. Google Maps kennt es nicht, aber man kennt dort auch nicht »Calcar« und »Cleve«, wie die nächsten Städte in alter Rechtschreibung (warum auch immer) im Roman genannt werden. Bei Kalkar horcht man vielleicht auf – und liegt richtig: Es geht um den sogenannten »Schnellen Brüter«, ein seinerzeit neuartiger Kernkraftwerk-Typ, geplant, bewilligt und gebaut in den 1970er Jahren und von da an fast immer umstritten und umkämpft. Als er fertig war, viele Jahre später, (natürlich waren die Baukosten explodiert) wollte ihn niemand mehr. Er ging nie ans Netz. Milliarden für Nichts. Naja, heute ist dort »Kernwasserwunderland«, ein Freizeitpark mit Kirmes und Disco.
Christoph Peters, 1966 in Kalkar geboren, ist der Autor dieses Dorfromans. Inwiefern jetzt der Ich-Erzähler tatsächlich Christoph Peters ist, wird nicht aufgelöst. Er bleibt im übrigen namenlos. Wie merkwürdigerweise auch alle anderen Protagonisten der engeren Familie – der Vater, die Mutter, die Geschwister – während es ansonsten vor Namen oder Spitznamen der Nenn- und richtigen Tanten und ‑Onkel, Großeltern, Cousinen und Cousins nur so wimmelt (ein Verzeichnis braucht man sich nicht anzulegen; die meisten bleiben Episode). Am Ende wird pflichtschuldig auf die Fiktion verwiesen; Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen seien nicht beabsichtigt.
Das Erzählprinzip ist zunächst gewöhnungsbedürftig. In den ungerade nummerierten Kapiteln, die mit römischen Ziffern versehen werden, erzählt ein etwa elfjähriger Junge (man kann anhand einiger Daten diesen Bereich ermitteln) in durchaus kindlichem Tagebuchduktus seine Erlebnisse in Schule, Elternhaus und Dorf. In den Kapiteln mit geraden, arabischen Ziffern, berichtet ein Ich-Erzähler von seinem aktuellen Besuch bei den Eltern und gerät aufgrund von zwei scheinbar belanglosen Begebenheiten in einen Erinnerungsstrom. Zum einen erkundigt sich der Vater nach Juliane, die, wie sich später herausstellt, erste Freundin des Ich-Erzählers (die allerdings, was die Eltern wissen müssten, schon länger verstorben ist). Zum anderen entdeckt der Sohn in seinem Kinderzimmer unter all den alten Gegenständen ein Schmetterlingsnetz, welches ihn nun vollends in die Zeit zurückschickt, in der er mit fünfzehneinhalb Jahren durch die heimische Flur spazierte und – mit Unterstützung seines Biologielehrers – Schmetterlinge bestimmte, fing und professionell präparierte um hieraus unter anderem Schlüsse über die abnehmende Artenvielfalt zu ziehen. Sein Berufswusch war damals Tierforscher; Bernhard Grzimek und Heinz Sielmann die Vorbilder.
Schnell wird deutlich, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt, die erzählt. Die Mutter, eine Zugereiste, die eigentlich nie ganz heimisch wurde, ist Lehrerin, der Vater »Traktorschlosser«. Sein Chef verkauft Landmaschinen, die er wartet und bei Bedarf repariert. Kundendienst hat oberste Priorität, auch wenn er nur Angestellter ist. Beide Elternteile sind um 1933 geboren. Der Bruder und die Schwester sind einige Jahre jünger als der Erzähler; sie kommen im Buch kaum vor. Man lebt im eigenen Haus, ist fleißig. Also das, was man später dann einmal »Spießer« nennt.
Im Dorf wohnen rund 400 Einwohner. Alles ist landwirtschaftlich geprägt; Bauern sind die heimlichen »Herren«, sofern sie Grundbesitz haben. Am wohlhabendsten sind diejenigen, die Teile ihres Landes verpachten können. Sie fahren Mercedes (wie auch der Vater). Nach außen scheint die Dorfgemeinschaft Mitte der 1970er Jahre noch in Ordnung. Man wählt zu 70% CDU, die wenigen SPD-Wähler werden aber toleriert (sofern man sie kennt – ein Abonnement der NRZ gilt als Indiz). Sonntags geht man zur Messe, wobei es schon fast einer Revolution gleichkommt, wenn Familien in der Kirche zusammensitzen und nicht der Trennung nach Geschlechtern folgen. Umweltschutz ist noch weitgehend ein Fremdwort. Die Fische im Rhein sind längst ungenießbar geworden; die Verschmutzung der Gewässer ist exorbitant.
Und dann gibt es diesen »Schnellen Brüter«, das geplante Atomkraftwerk, das Wandel und Wohlstand und Sicherheit der Stromversorgung in der Region verspricht. Neue Straßen statt Morastwege. Arbeitsplätze. Obwohl ihr Haus nur knapp 500 m vom zukünftigen Kernkraftwerk entfernt wäre, ist des Erzählers Vater für den Brüter (die Mutter schließt sich ihm an, denn schließlich haben sich Wissenschaftler und Politiker damit beschäftigt). Er sitzt im Kirchenvorstand, einem wichtigen Gremium im Dorf. Hier wird Politik gemacht. Die Bauern sind gegen den »Brüter«. Sie dominieren den Kirchenvorstand. Das Land, dass der Kirche gehört, ist billig und das soll so bleiben. Die Kirche hingegen will das Land an den Brüter-Bauherrn verkaufen. Man kann sich nicht einigen. Der Bischof löst den Kirchenvorstand einfach auf. Eine Ungeheuerlichkeit. Die Lage spitzt sich zu; es drohen angeblich sogar Enteignungen von Staats wegen. Der Kirchenvorstand wird neu gewählt; des Erzählers Vater ist involviert. Das Dorf ist gespalten. Es ist alles ungleich ernster als die Differenzen zwischen CDU- und SPD-Anhängern, die in den Kneipen nach einigen Bieren unwichtig werden. Den Andersdenkenden grüßt man nicht mehr, wechselt sogar die Straßenseite. Freundschaften, Stammtische, sogar Geschäftsbeziehungen zerbrechen. Wirte müssen sich zurückhalten, um nicht Gäste zu verlieren. Die Dorfgemeinschaft ist irgendwann zerrüttet. Dass jemand vom anderen »Lager« trotzdem ein anständiger Mensch sein kann – es ist nahezu undenkbar geworden.
Schließlich wären da noch die fremden AKW-Gegner. Ein Bauer stellt ihnen Land zur Verfügung. Sie errichten dort ein Camp, wünschen sich eine »Republik freier Niederrhein«. Der Erzähler erinnert sich, wie er mit fünfzehneinhalb und einem Schmetterlingsnetz (es galt einen Schwalbenschwanz zu fangen) plötzlich vor dem Camp der Kernkraftgegner steht und die lässig gekleidete 22jährige Juliane sieht. Er ist fasziniert von der Frau, von deren Lebensstil und ihrer Rhetorik, die eine unmittelbare Weltrettung verlangt – und zwar zu allererst, in dem man dieses Bauvorhaben mit all seinen Gefahren stoppt. Bisher hatte er nur die Vorurteile seiner Eltern über die Langhaarigen gehört. Die Leute im Camp sind halbwegs normal. Statt seinem Vater im Garten zu helfen, fasst er dort an. Es ist Juliane, die ihn nicht nur in Gewissenskonflikte stürzt, sondern auch – das musste ja kommen – in die Wonnen der Liebe.
Sie, die Tochter eines Richters, den sie als übriggebliebenen Nazi beschreibt, hat mit ihren Eltern endgültig gebrochen. Er bewundert diese Konsequenz, ist aber andererseits auch gespalten. Er erkennt durchaus seine Eltern an und möchte es sich auch nicht vollständig mit den Dorfbewohnern verderben, andererseits sieht er ein, dass man etwas für »die Welt« zu tun hat. Die bisweilen offenen Sympathien der Campbewohner für die RAF teilt er allerdings nicht. Die Masse der Protestler will gewaltlos bleiben. Aber der Zweifel ob der Wirksamkeit nagt an ihnen. Er lässt sich die Haare wachsen, rebelliert gegen Verbote seiner Eltern; er bricht jedoch nicht mit ihnen. Schmetterlinge fängt er nicht mehr.
Nun ist es erzählerisch problematisch, wenn Erwachsene – selbst wenn es autobiographisch grundiert ist – ihre Kinderstimme simuliert wieder aufleben lassen. Auch im »Dorfroman« wirkt die kindliche Naivität des 11jährigen bisweilen aufgesetzt; man sieht förmlich einen bebrillten Streber seine Urteile über Todesstrafe bei Terroristen (die er ablehnt) oder die Notwendigkeit einer sicheren Stromversorgung aufsagen. Peters braucht das, um den Leser in die Entwicklungen der Dorfgemeinschaft blicken zu lassen. Das Kind, dass nicht dumm ist, aber die jeweiligen ökonomischen oder sozialen Hintergründe nicht reflektiert, wird zum Lautsprecher des Sichtbaren – natürlich (noch) mit der entsprechenden Prägung durch die Eltern. Sentimentale Reminiszenzen über die »gute alte Zeit« finden so allerdings – glücklicherweise – kaum statt (naja, neben Grzimek und Sielmann noch ein bisschen Borussia Mönchengladbach, Lassie, Skippy und – wer kennt ihn noch? – Remy Ceulemanns). Im Kontrast mit den Kapiteln, die aus der Erinnerung des erwachsenen Erzählers gespeist sind, kann man die Wandlungen eines Menschen während der Pubertät erkennen.
Wer will, kann die realen Abläufe mit den Erzählungen rund um den Protest gegen den »Schnellen Brüter« abgleichen; besonders genau sind die Angaben im Roman jedoch nicht. Das Kind spiegelt vermutlich die Ereignisse um die Demonstration von 1977. Der Junge dann die Ausschreitungen von 1982, bei denen etliche Demonstranten zum Teil erheblich verletzt wurden. Die Schilderung der Polizeigewalt gerät dramatisch (viele aus dem Dorf begrüßen das »Durchgreifen«). Er möchte seiner Juliane und deren Freunden folgen, macht sich mit dem Fahrrad auf dem Weg, aber da sind die Prügeleien mit der Polizei bereits im Gang. Juliane wird verletzt, kommt ins Krankenhaus. Die inzwischen bereits etwas abgekühlte Beziehung mit Juliane wird immer komplizierter. Zudem verstärken sich die depressiven Schübe Julianes. Er erlebt dann auch die selbsternannten Weltretter ebenfalls als nicht konsequent. Sie verschmutzen beispielsweise mit ihren Abfällen ein Landschaftsschutzgebiet. Sie kiffen. Agieren planlos. Plötzlich ist dann die Frau verschwunden. In einem ganz kleinen Absatz wird der Leser aufgeklärt, dass Juliane wenige Monate danach tot in Holland aufgefunden wurde.
Nach der durcherinnerten Nacht kommen ihm am Morgen Überlegungen in den Sinn, wie die beiden Eltern bei zunehmender Gebrechlichkeit in dem Haus weiterleben können. Eine Verbringung in ein Heim scheidet aus. Nimmt man eine fremde Person zur Dauerpflege (die berühmte »Polin«?) ins Haus? Platz genug wäre vorhanden. Sie wollen es eher nicht. Die Koordinaten der Aufsicht verschieben sich. Die Kinder übernehmen zusehends die Rolle der Eltern. Aber wann? Schließlich fährt er früher als geplant zurück nach Berlin.
Am interessantesten wird der Roman, wenn er die Veränderungen des gesellschaftlichen Klimas innerhalb des Dorfes wie unter einem Brennglas konzentriert erzählt werden. Die Parallelen zur Gegenwart sind dabei verblüffend. Das betrifft nicht nur den für irre gehaltenen US-Präsidenten (damals Ronald Reagan – heute Trump). Damals wie heute geht es immer um nichts weniger als die Rettung der Welt. (Und sei es auch nur, wenn ein paar Bretter im Camp zusammengenagelt werden müssen.) Alarmismus nebst den allgegenwärtigen Weltuntergangsprophezeiungen der damaligen Kernkraftgegner finden sich beispielsweise in der heutigen »FFF«-Bewegung. Und bereits damals wurde die »Systemfrage« gestellt und eine »Überwindung« vor allem des Kapitalismus als erstrebenswert angesehen.
Ein »Diskurs« war innerhalb des Dorfes irgendwann nicht mehr möglich – eine ähnliche Diagnose wird auch heute häufiger getroffen. Auseinandersetzungen werden nicht mehr nur in der Sache geführt, sondern personenbezogen. Es gibt nur dafür oder dagegen. Kompromisse sind unerwünscht, Pragmatismus gilt als Schwäche.
Und es ist schon erstaunlich, wie der Elfjährige die Berichterstattung in den Fernsehmedien als einseitig zu Gunsten der »Brüter«-Gegner wahrnimmt (vor allem, wenn die Aussagen des Vaters nachher sinnentstellt im Bericht zusammengeschnitten werden). Auch hier kann man deutliche Analogien zum medialen Mainstream der Gegenwart erkennen.
Damals hieß es Fortschritt contra Status quo. Die Technik‑, verbunden mit einer fast rückhaltlosen Wissenschaftsgläubigkeit verhieß Fortschritt. Damals wurde »die Wissenschaft« als Autorität hinsichtlich der Notwendigkeit der Kernenergie zitiert. Dass es »die Wissenschaft« nicht gibt, das sie aus divergierenden Theoriegebäuden besteht, die sich immer wieder neu der Empirie stellen müssen, wurde ausgeblendet. Und auch heute wird gerne pauschal mit »der Wissenschaft« argumentiert, wenn es darum geht, Maximalforderungen zu rechtfertigen.
Der Gegenwartserzähler reflektiert am Ende durchaus selbstkritisch: »Wie lange kann man seine Illusionen aufrechterhalten, ohne im falschen Leben zu landen?« Er rekapituliert die Träume seines Vaters, sein Arbeitsethos, seine Hoffnungen, seine Sorge um die Kinder. Wie betrachtet er rückwirkend sein Leben? Wie mag er sich fühlen? Der Sohn fragt es nicht. Aber die Frage stellt sich auch allgemein nach den Illusionen aktivistischer Politikentwürfe.
Schon an der Widmung an die Eltern wird deutlich, dass es Peters nicht um einen Abrechnungsroman geht. Die Rechnungen seien, so schreibt er, »längst bezahlt«. Der Erzähler muss sich und anderen nichts beweisen. Niemand wird in diesem Buch diffamiert. Nüchtern und unverkrampft kann man eine stille Hommage an »Heimat« erkennen. Sicher, es wird ein Huhn geköpft und die Bauern sind ein bisschen grobschlächtig, aber allzu abgegriffene Dorfklischees werden vermieden. Auch wenn die Figur der Juliane ein bisschen zu stark stereotypisch angelegt ist (die Liebesbeschwörungen des Jungen sind ziemlich parfümiert, aber zum Glück selten). Man sollte Peters’ Erzählstil nicht mit Harmlosigkeit gleichsetzen. Ihm gelingt durchaus eine Verdichtung, ja er vermag sogar Spannung zu erzeugen (etwa wenn es um die neue Kirchenvorstandswahl geht; etwas, was man »Richtungsentscheidung« nennen könnte). Und es ist viel gewonnen, dass sich der Autor falscher Sentimentalität enthalten hat. Der ungeplante frühe Aufbruch, mit dem der Erzähler vor der Verantwortung für seine Eltern flüchtet, lässt Raum für einen weiteren Roman. Ich würde auch diesen sehr gerne lesen.

Mir hat der Roman und dieser Kommentar sehr gut gefallen. Der Kommentar hebt meines Erachtens die Stärken des Buches passend hervor. Möglicherweise kommt Juliane ein wenig zu kurz in dem Kommentar. Sie ist eine tragische junge Frau, die vielleicht den Teenager als Freund erwählt, weil er für sie keine Bedrohung darstellt. Sie ist von ihrem Vater, dem ehrwürdigen Richter, misshandelt worden und in eine gewaltfreie Traumwelt einer Kommune geflüchtet, die aber an der praktischen Realität und an der Aggressivität der Polizei scheitert. Der 16 Jahre alte Freund scheitert, ihr Halt und Unterstützung zu geben und sie begeht Selbstmord, weil sie – trotz ihres Intellekts und ihres Charisma- keine Perspektive mehr sehen kann. Das ist sehr traurig und der nüchterne Erzählstil, der nur in ganz kurzen Absätzen von dem Ende Julianes berichtet- passt und lässt dem Unsagbaren und Unfassbaren Raum für die Gefühle des Ich-Erzählers und des Lesers.