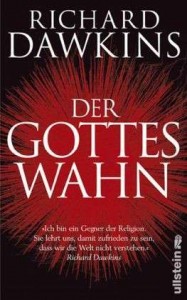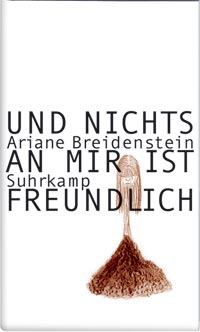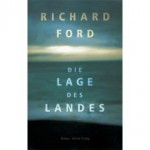Der Stallgeruch fehlte
In seinen letzten Interviews sprach der todkranke Kempowski viel von seiner späten Anerkennung. Von der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Seine Augen blitzten, als damals alle Leute für ihn aufgestanden waren. Späte Genugtuung eines Schriftstellers, der wie kaum ein anderer die Kluft zwischen »Kritik« und »Publikum« widerspiegelte. Jahrelang verramschte die Kritik seine Bücher – auch noch, als »Tadellöser & Wolff« von Eberhard Fechner kongenial und wunderbar verfilmt wurde. Man rümpfte in bestimmten Kreisen die Nase, weil Kempowski keinen »Stallgeruch« hatte. Den Büchnerpreis hat er nie bekommen – ein Skandal! Seine Prosa war weder experimentell noch Betroffenheitskitsch und widersprach lange dem gesellschaftspolitischen Zeitgeist. Man hatte sich in einer Jugendzeit im Nationalsozialismus nicht irgendwie wohlzufühlen gehabt. Kempowski hat sich – glücklicherweise für die Literatur! – niemals diesen Imperativen gebeugt. Er war und blieb das, was man einen unabhängigen Geist nannte. Seine Flucht war nicht die in die Literatur, sondern – umgekehrt zu vielen anderen – die in den Schuldienst. Kempowski war aber kein Studienrat, der auch schrieb – er war ein Schriftsteller, der Lehrer war.
1990 wurde Kempowski in einer üblen Kampagne des Plagiats bezichtigt. Endlich nahm sich die Grosskritik seiner an – Hellmuth Karasek stellte die Fakten klar und entlastete Kempowski in einem fulminanten Artikel im »Spiegel«. Zu dieser Zeit steckte Kempowski in einem riesigen Projekt, dem »Echolot«. 1999 erschienen die ersten vier Bände dieses »Echolots«. Es sollten noch weitere acht Bände folgen.