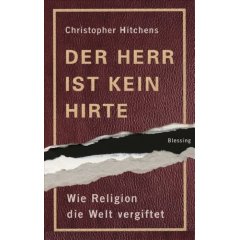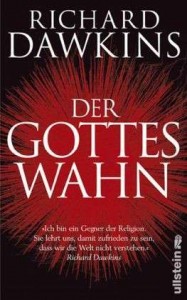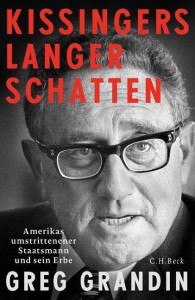
Kissingers langer Schatten
Man muss Greg Grandins »Kissingers langer Schatten« wirklich bis zum Schluss, d. h. inklusive der Danksagung am Ende des Buches lesen. Denn hier finden sich nicht nur die üblichen Worte an Helfer, Lektoren, Freunde oder Familie sondern auch der Dank an den 2011 verstorbenen Christopher Hitchens. Zugleich emanzipiert sich Grandin von Hitchens Vorgehensweise in dessen Anklageschrift »Die Akte Kissinger« aus dem Jahr 2001. Hitchens »selbstgerechte Empörung« habe verhindert, die »Wirkungsmacht seiner [Kissingers] Ideen…zu erklären«. Er sei derart auf sein Studienobjekt fixiert gewesen, dass die »äußeren Bedingungen seines [Kissingers] politischen Handelns unreflektiert« geblieben wären. Dadurch sei ihm »Wesentliches entgangen«.
Grandins Kritik ist deshalb so bemerkenswert, weil man sie ebenso auf sein Buch anwenden kann. Obwohl er mehrfach einer Dämonisierung Kissingers das Wort redet, passiert genau dies. So, als würden die Fakten nicht ausreichen, flüchtet er sich in zuweilen abenteuerliche Kausalitäten und, was noch schlimmer ist, in Vermutungen. So wird berichtet, dass Kissinger den Krieg zwischen dem Irak und den Iran (»Erster Golfkrieg« von 1980 bis 1988) befürwortet, seinerzeit »die Iraker als ein Gegengewicht gegen den revolutionären Iran« gesehen und Unterstützung für Saddam Hussein vorgeschlagen habe. So weit, so gut. Als reiche dies nicht aus, bringt Grandin noch einen vermeintlichen Ausspruch Kissingers: »Schade, dass sie [Irak und Iran] nicht beide verlieren können«. Das Problem ist allerdings, dass es Kissinger gesagt haben soll, was zwar sowohl im Text als auch in einer Fußnote am Ende der Seite klargestellt wird: »Dieses Zitat ist nicht zweifelsfrei belegt«. Aber warum erscheint es dann überhaupt im Buch? Grandin benennt mit Raymond Tanter, einem ehemaligen Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats der USA, noch einen Kronzeugen, der gesagt haben soll, dass Kissinger im Oktober 1980, also rund vier Wochen nach Beginn des Krieges, dass die »Fortsetzung der Kämpfe zwischen Iran und Irak im Interesse Amerikas sei«. Eine Quelle für dieses Zitat fehlt dann allerdings.